Archiv - Bücher
Martin Bruny am Sonntag, den
31. Mai 2020 um 07:53 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2020
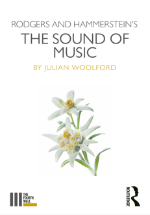 22 Titel umfasst die Buchserie »The Fourth Wall«, die der Verlag Routledge 2016 mit einem Band zu Harold Pinters »Party Time« startete. Der Verlag charakterisiert die Reihe folgendermaßen: »Fourth Wall books are short, accessible accounts of some of modern theatre’s best loved works. They take a subjective but easily digestible approach to their topics, allowing their authors the opportunity to explore their chosen subject in a way that is absorbing enough to be of use both to lovers of theatre and those who are being asked to study a play more deeply. Each book in the series looks at a specific play, variously exploring its themes, contexts and characteristics while prioritising original, insightful writing over complexity or scholarly weight.« Acht Bände widmen sich Musicals: »My Fair Lady«, »Sunday Afternoon«, »Into the Woods«, »Sweeney Todd«, »Les Misà©rables«, »Hedwig and the Angry Inch«, »The Book of Mormon« und, 2020 erschienen: »The Sound of Music«.
22 Titel umfasst die Buchserie »The Fourth Wall«, die der Verlag Routledge 2016 mit einem Band zu Harold Pinters »Party Time« startete. Der Verlag charakterisiert die Reihe folgendermaßen: »Fourth Wall books are short, accessible accounts of some of modern theatre’s best loved works. They take a subjective but easily digestible approach to their topics, allowing their authors the opportunity to explore their chosen subject in a way that is absorbing enough to be of use both to lovers of theatre and those who are being asked to study a play more deeply. Each book in the series looks at a specific play, variously exploring its themes, contexts and characteristics while prioritising original, insightful writing over complexity or scholarly weight.« Acht Bände widmen sich Musicals: »My Fair Lady«, »Sunday Afternoon«, »Into the Woods«, »Sweeney Todd«, »Les Misà©rables«, »Hedwig and the Angry Inch«, »The Book of Mormon« und, 2020 erschienen: »The Sound of Music«.
Eine erstaunliche Verlagsstrategie vorab. Band 1 (»Party Time«), ist (nach wie vor) in drei Kaufformaten erhältlich. Das 70 Seiten starke Buch kostet in der Hardcover-Ausgabe nicht weniger als 160 Pfund, als E-Book & Paperback 8,99 Pfund. 2017 senkte man den Hardcover-Preis neu erscheinender Titel auf 120 Pfund, seit 2018 werden keine Hardcover-Ausgaben neu veröffentlichter Werke dieser Serie angeboten. Nicht wirklich verwunderlich.
Julian Woolworth, Schauspielschulleiter, Regisseur und Schriftsteller, analysiert in seinem Büchlein zu »The Sound of Music« in erster Linie das Bühnenmusical, widmet sich aber auch den Filmversionen. Seine Methodik beruht darauf, Bezüge herzustellen. Er ordnet ein, etikettiert. So zeigt er Parallelen zwischen »The Sound of Music«, »King and I« auf. Das Musical sei »a rewrite of The King and I, a kindly governess battles a despotic father for the love of the children and brings liberalism into the household«m verortet das Werk in der Biografie von Rodgers und Hammerstein in vielerlei Hinsicht, flicht ein, dass »Edelweiss« das letzte gemeinsam geschriebene Lied ihrer letzten gemeinsamen Show sei. Er vernetzt das Musical mit der Gegenwart, etwa indem er die Bedeutung des Songs »Edelweiss« als Titelmelodie (gesungen von Jeanette Olsson) der nach einer literarischen Vorlage von Philip K. Dick entstandenen Fernsehserie »The Man in the High Castle« (Amazon Studio, 2015–2019) analysiert. Die Methode der Amerikaner, aus der Geschichte der Trapps und dem deutschsprachigen, in den USA gefloppten Film »Die Trapp Familie« (1956) letztlich einen Erfolg auf der Bühne und im Film zu machen, bezeichnet er als »Ghosting«: »As is so often the case with true stories, the effect is to alter the perception of the real events so that, after time, audiences believe they are seeing something that is closer to the truth than they actually are in reality and the adaptive choices made by writers are ignored. This is sometimes referred to as ghosting; a process by which stories become reinterpreted creatively and the true story becomes merely a ghost in the background.« Ein eigenes Kapitel ist dem späten Erfolg der Bühnenversion in Österreich gewidmet, hier illustriert er auf amüsante Weise, welche Bedeutung die Show da hat: »In 2014 a contestant on Die Millionen Show was asked a € 70,000 question that would surely have been in an earlier round in any other country: What small flower is the title of a song from The Sound of Music?. The contestant didn’t know the answer and, even after phoning a friend, she chose another flower, despite Edelweiss being the national flower of Austria.« Flott geschrieben, interessante Details als Highlights. Empfehlenswert.
Julian Woolford: Rodgers and Hammerstein’s »The Sound of Music« (The Fourth Wall). Abingdon 2020. 74 S.; (Paperback) ISBN: 978-1-138-68283-2. £ 6.99 routledge.com
Martin Bruny am Sonntag, den
31. Mai 2020 um 07:48 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2020
 Deutschland 1932. Die Brüder Peter und Alfred Rotter bespielen neun Theater: das Metropol-Theater (dessen Kern in der heutigen Komischen Oper erhalten geblieben ist), das Theater des Westens, das Lessing-Theater, den Admiralspalast, Lustspielhaus, Zentraltheater Berlin, Zentraltheater Dresden, Alberttheater Dresden, Mellini-Theater Hannover. Für Komödien und Dramen haben sie auch noch das Deutsche Künstlertheater und das Theater in der Stresemannstraße (heute: Hebbel am Ufer) in ihrem Portefeuille. Und die Plaza in Friedrichshain mit 3000 Sitzplätzen. Sie manövrieren mit Wagemut zwischen Erfolg und Bankrott, mitten in der Wirtschaftskrise.
Deutschland 1932. Die Brüder Peter und Alfred Rotter bespielen neun Theater: das Metropol-Theater (dessen Kern in der heutigen Komischen Oper erhalten geblieben ist), das Theater des Westens, das Lessing-Theater, den Admiralspalast, Lustspielhaus, Zentraltheater Berlin, Zentraltheater Dresden, Alberttheater Dresden, Mellini-Theater Hannover. Für Komödien und Dramen haben sie auch noch das Deutsche Künstlertheater und das Theater in der Stresemannstraße (heute: Hebbel am Ufer) in ihrem Portefeuille. Und die Plaza in Friedrichshain mit 3000 Sitzplätzen. Sie manövrieren mit Wagemut zwischen Erfolg und Bankrott, mitten in der Wirtschaftskrise.
In der Weimarer Republik galten die Rotters als die Theatermacher, 1929 schrieb die »New York Times«: »The Berlin operetta situation is in the hands of the Rotter brothers.« Kaum ein Operettenschlager dieser Zeit, der nicht auf ihren Bühnen seinen Ausgang genommen hat: »Friederike«, »Land des Lächelns«, »Ball im Savoy«. Aber »in Wirklichkeit sind die Rotters […] längst weiter – auf einer neuen Spur. Ralph Benatzkys Mit dir allein auf einer einsamen Insel nach einem Libretto von Arthur Rebner weist bereits den Weg zum deutschen Musical. Diese Benatzky-Operette, die zuvor am Residenz-Theater in Dresden – ebenfalls eine Rotterbühne – uraufgeführt worden ist und mächtig eingeschlagen hat, kommt im Mai 1930 ausgereift ans Metropol-Theater, dem Haupthaus der Rotters, und verdrängt Tauber und Das Land des Lächelns in die Abspielstätte Theater des Westens. Benatzky entwickelte das musikalische Singspiel – ein Genre, in dem er führend wurde.«
Kamber, ein Schweizer Soziologe, Theater- und Romanautor sowie Journalist, der in Berlin lebt, beschäftigte sich viele Jahre mit der Biografie der Berliner Theaterdirektoren Peter und Alfred Rotter. Sein Buch ist akribisch recherchiert, jedes Detail mit überprüfbaren Fakten untermauert. Es ist erstaunlich, was er an Daten und Geschichten aus den zeitgenössischen Quellen zu dieser packenden Biografie destillieren konnte. Und der Verlag Henschel hat diesem Buch ein elegantes Layout (Layout/Satz von flamboyant) anpassen lassen: liebevolle Details, perfekte Papierwahl, ein Lesebändchen, eine Vielzahl an Bildern, wirksam eingesetzt. Ein Traum von einem Buch in jeder Hinsicht für alle, die an Theatergeschichte interessiert sind.
Peter Kamber: Fritz und Alfred Rotter. Henschel, Leipzig 2020. 504 Seiten.; (Hardcover) ISBN 978-3-89487-812-2. € 26,–. henschel-verlag.de
Martin Bruny am Dienstag, den
10. März 2020 um 08:06 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2020
 Dan Dietz hat wieder zugeschlagen und seine 2014 gestartete, erfolgreiche Buchserie »The Complete Book of … Broadway Musicals« ergänzt – sie liegt nun von den 1920er- bis zu den 2000er-Jahren geschlossen vor. Wer alle neun Bände erworben hat, verfügt über ein Werk von 5088 Seiten zu einem Preis von rund 1300 US-Dollar.
Dan Dietz hat wieder zugeschlagen und seine 2014 gestartete, erfolgreiche Buchserie »The Complete Book of … Broadway Musicals« ergänzt – sie liegt nun von den 1920er- bis zu den 2000er-Jahren geschlossen vor. Wer alle neun Bände erworben hat, verfügt über ein Werk von 5088 Seiten zu einem Preis von rund 1300 US-Dollar.
Für die Statistiker ist dies eine wunderbare Edition. Man kann anhand der Daten spannende Zeitläufte ablesen. Wobei die 1920er-Jahre geradezu eine Blütezeit darstellen. Für diesen Zeitraum listet Dietz eine Einheit von 287 Book Musicals, neuen Opern sowie Book Musicals, die in Europa entstanden sind und am Broadway ihre US-Premiere feierten, auf. Diese Musicals aus Europa wurden im Allgemeinen mit zusätzlichen Songs amerikanischer Texter und Komponisten bestückt. Im Jahrzehnt darauf war die Situation bereits eine ganz andere: In den 1930er-Jahren gab es nur mehr 128 Produktionen dieser Art. Und bis zu den 2000er-Jahren sank der Output auf 57 Produktionen.
Für den Zeitraum von den 1930er- bis zu den 2000er Jahren lassen sich interessante Zahlenabfolgen ablesen: Die Anzahl der reinen Book Musicals (mit eigens komponierter Musik) entwickelte sich folgendermaßen (Anzahl der Shows pro Jahrzehnt): 94-80-71-98-84-50-32-37. Dem entspricht die Risiko-Kurve: Von den 1930er- bis zu den 2000er Jahren überstanden immer mehr Shows die Tryout-Phase: Am höchsten war die Anzahl der Shows, die es nicht bis zur Premiere schafften, in den 1940ern (56), in den 1970ern waren es 29 Produktionen und in den 1990ern und 2000ern 16 bzw. 13.
Aber zurück in die wilden Zwanziger: Was die Long Runs dieses Jahrzehnts betrifft, so brachten es 18 Shows auf mehr als 400 Vorstellungen. Die Top 3: »The Student Prince« (608 Vorstellungen; Buch/Texte: Dorothy Donnelly; Musik: Sigmund Romberg), »Show Boat« (572 Vorstellungen; Buch/Texte: Oscar Hammerstein II; Musik: Jerome Kern) und »Sally« (570 Vorstellungen; Buch: Guy Bolton; Texte: Clifford Grey; Musik: Jerome Kern).
Nicht in den Top 3 vertreten, aber als größte finanzielle Erfolge des Jahrzehnts gefeiert: »No, No, Nanette« (Buch: Otto Harbach, Frank Mandel; Texte: Irving Caesar, Otto Harbach; Musik: Vincent Youmans) und »Rose-Marie«/Texte: Otto Harbach, Oscar Hammerstein II; Musik: Rudolf Friml, Herbert Stothart), die auf Tourneen erfolgreich waren und sich international durchsetzen konnten.
Von »No, No, Nanette« gab es in 27 Ländern Produktionen, am Broadway reichte es indes nur für 321 Vorstellungen, und das, obwohl aus dieser Show die Evergreens »Tea for Two« und »I Want to Be Happy« stammen. Bereits vor der Broadway-Premiere (16.9.1925, Globe Theatre, dem heutigen Lunt-Fontanne Theatre) wurden am 14. Mai 1925 die Notenblätter zu »No, No, Nanette« publiziert. »Tea for Two« wurde zum Hit und danach zum Evergreen, von dem mehr als 80 Coverversionen veröffentlicht wurden. 1963 zählte das Lied zu den 16 erfolgreichsten Musikwerken aller Zeiten. Aber worauf ist das bescheidene Abschneiden des Musicals damals in New York zurückzuführen? Zum einen auf eben die erfolgreiche Tour vor der Broadway-Premiere, absolviert von drei parallel spielenden Companies mit mehrmonatigen Spielserien in Detroit, Chicago, Boston und Philadelphia. Sechs Monate vor der New Yorker Premiere war das Musical auch in London schon am Spielplan. Und dann war da noch etwas: »The season was rich in new hits, and in fact Nanette’s opening was part of a history-making Broadway week. Within the seven-day period of Nanette’s premiere, three other successes opened (Richard Rodgers and Lorenz Hart’s Dearest Enemy, Rudolf Friml’s The Vagabond King, and Jerome Kern’s Sunny), and never before and never again would four consecutive smash hit musicals open during such a short time period. And soon more new shows were on the boards, some hits, others not, but all in all, they constituted more choices for the public: Jerome Kern’s The City Chap, Sigmund Romberg’s Princess Flavia, Irving Berlin’s The Cocoanuts, the Gershwins’ Tip-Toes, George Gershwin (and Herbert Stothart’s) The Song of the Flame, and Rodgers and Hart’s The Girl Friend. In addition to a number of well-received revues, there were hold-overs from the previous season, including Rose-Marie, The Student Prince in Heidelberg, and Louie the 14th.
Die ausführliche Beantwortung solcher Fragen macht die Schmöker von Dan Dietz so lesenswert. Es handelt sich nämlich natürlich auf der einen Seite um Nachschlagewerke mit enzyklopädischem Charakter. Für jede Show gibt es Angaben zu Aufführungsort, Premierendatum, Anzahl der Aufführungen, Kreativteam, Cast; eine Auflistung aller Songs und Awards sowie eine Inhaltsangabe. Zusätzlich jedoch liefert Dietz ausführliche Kommentare und Texte etwa zur Rezeptions- und Produktionsgeschichte, seine Einschätzung, Bewertung anhand von Kritiken und Zeitungsartikeln und Angaben zu etwaigen Revivals. Im Fall von »Nanette« kam es am Broadway 1971 zu einer Neuproduktion (Premiere 19.1.1971 im 46th Street Theatre, dem heutigen Richard Rodgers Theatre), die es auf 863 Aufführungen brachte. 1986 gingen fünf konzertante Vorstellungen in der Carnegie Hall über die Bühne, 1988 kam es zu 32 Vorstellungen einer Produktion der New Yorker Equity Library, und schließlich gab es am 8. Mai 2008 einer Aufführung im Rahmen der Encores!-Serie im New York City Center. Auch für all diese Produktionen liefert Dietz interessante Facts. Weiters bespricht er die Verfilmungen des Musicals aus den Jahren 1930, 1940 und 1950 (»Tea for two«) und noch so vieles mehr.
Reichlich Stoff zum Nachschlagen und Googeln bieten die diversen Anhänge. Etwa jener, der Shows auflistet, die ihre Proben-Phase nicht überlebten. Da findet man etwa 1929 »The Dutchess of Chicago« (»Die Herzogin von Chicago«), Emmerich Kà¡lmà¡ns Operette, die 1928 ihre Uraufführung im Theater an der Wien erlebt hatte. Besser erging es einer Produktion, die 1924 im Theater an der Wien ihre Uraufführung hatte und am 18. September 1926 ihre Broadway-Premiere feierte: »Countess Maritza« (»Gräfin Maritza«), ebenfalls von Emmerich Kà¡lmà¡n und mit 321 Vorstellungen ein Erfolg.
Hoffentlich lässt Dietz demnächst noch einen Band zu den 2010er-Jahren nachfolgen.
Dan Dietz: The Complete Book of 1920s Broadway Musicals. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2019. 652 S.; (Hardcover) ISBN 978-1-5381-1281-6. $ 150,–. rowman.com
Martin Bruny am Montag, den
10. Februar 2020 um 23:55 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2020
Auf die Suche danach, was Elton John in seiner Autobiografie zum Thema Musical zu sagen hat, habe ich mich begeben. Kann nicht so schwer sein, dachte ich mir. Er wird diesem erfolgreichen Abschnitt in seinem Werk sicher ein eigenes Kapitel widmen.
Autobiografien zu gliedern, ist einfach. Die leserfreundlichste Variante: sprechende Kapitelüberschriften. Daran hält sich natürlich auch Elton John und nennt sie: Prolog, eins, zwei, drei, vier, fünf bis siebzehn. Ein Lektor hat vielleicht eingeworfen, das sei doch ein wenig fade, aber vielleicht war es ein Zeitproblem. Das Cover zu entwerfen, soll Monate gedauert haben, erzählt Pan MacMillans Artdirektor auf thebookseller.com: »We started early on the hunt for that perfect image, and it quickly became apparent that there wasn’t an easy solution. Both publishing teams in the US and UK spent many months analysing countless photographs. Recent images didn’t convey the breadth of such a long career, and earlier images were either too specific to an era, or had already been used on a biography. There was another problem. Elton John’s trademark sunglasses often prevented good eye contact. At this point I wondered if I should avoid the photographic route. Maybe the cover should just use type, or a visual icon. But when I tried these options, there wasn’t enough of a connection or enough warmth.«
Nächster Step auf der Suche nach Musicalinhalten: das Register. Interessant: In der englischsprachigen Ausgabe ist ein traditionelles Gesamtregister vorhanden, die deutschsprachige Ausgabe bietet die Stichwörter aufgesplittet. Es gibt »Wichtige Ereignisse«, ein »Personenregister«, ein »Sachregister«, eines zu den »Alben«, noch eines zu »Songs/Singles«. Wo schaut man nach, wenn man »The Lion King« sucht? Im Sachregister? Kein Eintrag. Man findet »The Lion King« unter »Wichtige Ereignisse«. Wichtige Ereignisse im Umfeld von »The Lion King (1994/1997)«: »1994: Einführung in die Rock and Roll Hall of Fame; 1997: Party zum 50. Geburtstag, Mord an Gianni Versace und Beerdigung, erfährt von Prinzessin Dianas Tod, Prinzessin Dianas Beerdigung; 1998: Ritterschlag« In diesem Registerteil ist sonst kein Musical verzeichnet. »Billy Elliot«, offensichtlich nicht wichtig, findet man im Sachregister, ebenso wie »Aida«, für Elton John übrigens »ein harter Brocken«: »Es gab Probleme mit dem Bühnenbild, die Regisseure und Szenenbildner wurden ausgewechselt, und ich verließ eine der Generalproben am Broadway mitten im ersten Akt, nachdem ich bemerkt hatte, dass einige Songarrangements nicht so wie gewünscht geändert wurden. Wenn schon niemand auf meine freundliche Bitte hörte, würde man mir vielleicht zuhören, wenn ich wutentbrannt aus dem Theater stürmte.«
Reizvoll wird es, wenn einerseits Elton John Flops ironisch kommentiert und mit seinem Privatleben verschränkt und andererseits die Tücken der deutschen Bearbeitung deutlich werden. Aus »Luckily, I followed Billy Elliot up with The Vampire Lestat, a musical Bernie and I wrote together, which bombed – everything went wrong, from the timing, to the staging, to the dialogue – and normal service was resumed: it provided my mother with the unmissable opportunity to inform me that she had known from the start it would be a terrible flop« wurde im Deutschen: »Auf Billy Elliot folgte glücklicherweise Lestat, ein Musical, das Bernie und ich gemeinsam geschrieben hatten und bei dem vom Timing über die Inszenierung bis hin zu den Dialogen alles gründlich in die Hose ging, sodass die Vorstellung am Broadway schließlich eingestellt wurde …« Puh. Verzeichnet ist »Lestat« in der deutschsprachigen Ausgabe im Register »Alben«. Veröffentlicht wurde diese Cast-CD allerdings nie. Die englischsprachige Ausgabe listet »Lestat« einerseits unter »Soundtracks and Musicals«, andererseits als eigenes Stichwort (»Vampire Lestat, The musical«).
Was man im Buch nicht als konkrete Angabe findet: Geschrieben hat es der Musikkritiker des »Guardian«, Alexis Petridis. Er wird in der Widmung erwähnt: »Ein besonderer Dank an Alexis Petridis, ohne den dieses Buch nicht möglich gewesen wäre.« Was hier nett formuliert ist, bedeutete für den Journalisten dreieinhalb Jahre Arbeit, die er in einem Artikel für den »Guardian« so schilderte: »I’d travel to wherever he was, he’d talk about his past with startling candour, hooting with laughter at the awfulness of his behaviour or the sheer preposterousness of his own success: Me and Bernie [Taupin] used to look at each other all the time, utterly baffled, like, What the fuck is happening to us now?«
Der Stellenwert des Musicalgenres in diesem Buch (ca. acht Seiten von 496) mag der Erwartungshaltung der meisten Käufer entsprechen – oder aber dem, was ein Popjournalist bereit war, zuzulassen. Anekdoten über Bob Dylan, harte Worte über Michael Jackson, Einzelheiten zur Freundschaft zu Stars wie David Bowie, Freddie Mercury, das ist es vermutlich, was die Leute lesen wollen – und bekommen. 1976 traf Elton John Elvis Presley im Capital Centre in Landover, Maryland. Er nahm seine Mama mit. Über dieses Erlebnis reflektiert er: »Das Bild, das ich von diesem Abend im Kopf behalten habe, ist Elvis, wie er Schals an die Frauen im Publikum verteilt. In der Vergangenheit war er berühmt dafür gewesen, Seidenschals auf der Bühne zu verteilen […] Aber die Zeiten hatten sich eindeutig geändert, und diese Schals hier waren billige Nylondinger. Sie sahen nicht aus, als würden sie lange halten. Das Gleiche galt für Elvis selbst, wie meine Mama treffend anmerkte. In einem Jahr wird er tot sein, sagte sie, als wir gingen. Sie sollte recht behalten.«
Was fehlt in diesem Buch, sind Einblicke in Aufnahmesessions, Details zu Schaffensprozessen werden erwähnt, aber eher als atmosphärisches Element, zu vage, um eine eventuelle Neugier zu befriedigen. Apropos: Wenn es um Drogen geht, kann Elton sehr konkret werden: »Poppers waren in den Schwulenclubs der Siebziger eine große Sache. Man inhalierte es und bekam ein kurzes, legales, euphorisches Hochgefühl. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber die Marke meiner Wahl hieß Cum, und sie hatte einen besonders transformativen Effekt auf Rod [Stewart]. Ich bot ihm etwas an, und nachdem er stundenlang an seinem Stuhl geklebt hatte, sprang er plötzlich auf und tanzte die restliche Nacht durch. Pausen legte er nur noch ein, wenn er mehr wollte: Äh, hast du noch was von dem guten Cum, Sharon?« Dagegen hat es »Hakuna Matata«, der Song »über das furzende Warzenschwein«, halt schwer.
Elton John: Ich. Die Autobiografie. Wilhelm Heyne Verlag, München 2019. 496 S.; (Hardcover) ISBN 978-3-453-20292-4. € 26,00. heyne.de
Martin Bruny am Donnerstag, den
16. Januar 2020 um 03:22 · gespeichert in Musical, Wien, Rezensionen, Bücher
Die Idee zu seinem Buch »Rise up!« kam dem Theaterkritiker der »Chicago Tribune« Chris Jones 2016, als er sich die Tony Awards ansah. Die Kurzvorstellung des Musicals »Hamilton« übernahmen bei diesem Event per Videobotschaft Barack und Michelle Obama. Es war dies das erste Mal, dass eine Theaterproduktion im Rahmen einer Oscar-, Emmy- oder Tony-Awards-Verleihung von einem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anmoderiert wurde. Die Kernfrage des Buches sollte für den Autor folgende werden: Wie konnte es gelingen, »Hamilton« im Zentrum des amerikanischen aktuellen politischen Diskurses zu platzieren?
Jones analysiert eine Reihe von Sprechstücken und Musicals in Bezug darauf, wie sie dazu beigetragen haben, »Hamilton« zu ermöglichen. Seine Auswahl mag bisweilen absurd erscheinen. Disneys »The Lion King«, der Megaflop »Spider-Man: Turn Off the Dark« als Meilensteine zu »Hamilton«? Es gelingt dem Autor indes, Faktoren zu isolieren, die schlüssig sind.
Am Beginn seiner Argumentationskette steht Tony Kushners »Angels in America«, das, 1991 in San Francisco uraufgeführt, 1993 am Höhepunkt der Aids-Krise seine Broadway-Premiere hatte. Das Geheimnis des Erfolgs dieses Stücks sei die Idee dahinter, Theater habe relevant zu sein und sich mit aktuellen konkreten Problemen zu beschäftigen. Es war, so Jones, der Moment, in dem das Theater lernte, nicht mehr bedeutungslos zu sein. Ein Stück über ein Thema ins Theater zu bringen, das die Menschen gerade bewegt, sei eine der Erfolgsformeln von »Hamilton«.
Wie sehr »Hamilton« geradezu politisiert, analysiert Jones anhand von vielen Beispielen. Im November 2016 etwa besuchte der gerade zum Vizepräsidenten der USA nominierte Mike Pence die Broadway-Produktion. Am Ende der Vorstellung, Pence war im Gehen, wandte sich Darsteller Brandon Victor Dixon an das Publikum und an Pence, der innehielt und zuhörte. Dixon verlas eine knapp gehaltene Rede (die »Hamilton«-Autor Lin Manuel Miranda, der Regisseur der Show Thomas Kail und Produzent Jeffrey Seller spontan geschrieben hatten). Die entscheidenden Worte: »We sir, we are the diverse America who are alarmed and anxious that your new administration will not protect us, our planet, our children, our parents or defend us or uphold our inalienable rights, sir. But we truly hope that this show has inspired you to uphold our American values and to work on behalf of all of us. All of us.« Nur Stunden später tweetete der gewählte, aber noch nicht ins Amt eingeführte Präsident Trump die erste einer bis heute anhaltenden Reihe von kontroversiellen Messages: »Our wonderful future V.P. Mike Pence was harrassed last night at the theater by the cast of Hamilton, cameras blazing. This should not happen!«
Sucht man einen vergleichbaren Fall in der Theatergeschichte Österreichs, wird man zum Beispiel im Jahr 2015 fündig. Damals besuchte der damalige FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache mit seinem Stellvertreter Johann Gudenus (die beiden Protagonisten der Ibiza-Affäre des Jahres 2019) eine Vorstellung des »Jedermann« am Salzburger Domplatz. Das Schauspielerensemble bemerkte die Anwesenheit der Vertreter der FPÖ, und spontan stimmten die Musiker des Ensembles beim Einzug der Tischgesellschaft die »Internationale« an. Ein Zeichen des Protests. Ganz im Gegensatz zu den Verantwortlichen des Richard Rodgers Theater, die sich mit den Hamilton-Darstellern solidarisch zeigten, distanzierte sich die Direktion der Salzburger Festspiele vom Protest. »Private oder politische Meinungskundgebungen der Künstler haben in keiner der Vorstellungen der Salzburger Festspiele die Billigung der Festspielleitung, und wir haben das Ensemble ausdrücklich darauf hingewiesen, dergleichen in Zukunft zu unterlassen«, ließ der künstlerische Direktor Sven-Eric Bechtolf in einer Stellungnahme wissen.
Die Bühne einer rechten Partei für eine Selbstpräsentation zu überlassen, das schafften die VBW im Februar 2019, als ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler den Musicalsängern Lukas Perman und Marjan Shaki nach einer Aufführung der Produktion »I Am From Austria« das »Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich« übergab. Schon etwas absurd, sich für Erdbebenopfer in Haiti einzusetzen und sich dann ausgerechnet von einem Mitglied einer rechten Partei, und wir wissen, wofür diese Partei unter ihrem Führer Kurz steht, auszeichnen zu lassen. Und so wie Karin Kneissl, ehemalige Außenministerin, nie müde würde, die Medien mit netten Geschichten über ihre Hunde zu füttern (siehe dazu eine Analyse der Gründe –>hier), nutzte Edtstadler natürlich prompt diesen Auftritt, um sich als das nette Dirndl von anno dazumals zu geben, das mit dem lieben Lukas mal Oboe gespielt hat (siehe dazu –> hier). Nur nebenbei erwähnt: Diese Auszeichnung gebührt zumindest zu einem Teil auch allen jenen, die gratis an den Charity-Konzerten beteiligt waren.
Und was hat nun »The Lion King« mit »Hamilton« zu tun? Jones analysiert in seinem Buch unter anderem Schlüsseljahre, etwa 2001, das Jahr von 9/11, aber auch das Jahr 1997. Damals gelang es »Titanic« als erstem Film, mehr als eine Milliarde Dollar einzuspielen, es war das Jahr, in dem Bloomsbury Publishing in England den ersten Harry-Potter-Band veröffentlichte, damit das Verhältnis von Büchern und Familien für immer änderte und ein weltweites Kulturphänomen schuf. Gianni Versace wurde 1997 erschossen, Lady Di starb, und zwei Milliarden Menschen verfolgten ihr Begräbnis live via TV – und es war das Jahr, in dem »The Lion King« seine Broadway-Premiere feierte. Als erstes Broadway-Musical sollte es »The Lion King« schaffen, mehr als eine Milliarde Dollar einzuspielen. 20 Jahre später spült die Show nach wie vor zwei Millionen Dollar pro Woche in die Kassen. Ein Teil des Erfolgsrezepts: Die Show ist multiethnisch und multinational. Sie spielt in Afrika und Amerika, die Rollen sind großteils mit Afroamerikanern besetzt. Es war das erste Broadway-Megamusical, das sich global anfühlte, weltumspannend und kinderfreundlich. »Most important of all, The Lion King bathed its audience in comfort and hope. Like Angels in America and Rent, it insisted that the dead still can love, and that it is possible to walk yourself back from the brink and burst into renewed life.«Und es war die Show von Julie Taymor, womit auch der Konnex zu »Spider-Man« geknüpft ist, eine Show, die Jones ausführlich auf Lehren abklopft, die Produzenten aus diesem Megaflop ziehen konnten.
Jones schreibt mit diesem Buch Musicalgeschichte der Gegenwart, etwas, worum sich viel zu wenige bemühen, mag sein aus Mangel an relevanten Themen, die sich aus gegenwärtigen Musicals ziehen lassen. Er beantwortet mit seinem Buch die immer wieder gestellte Frage, wozu es überhaupt Kritiken gibt. Kritiker werten, ordnen ein, stellen Zusammenhänge her. Jede Stimme zählt, Argumente überzeugen. »Rise up!« ist ein Plädoyer für Musicals mit Bedeutung und von Relevanz.
Chris Jones: Rise up! Broadway and American Society from »Angels in America« to »Hamilton«. Bloomsbury, Methuen Drama, London 2019. 226 S.; (Paperback) ISBN 978-1350071933. £ 17.99. bloomsbury.com
Martin Bruny am Dienstag, den
5. November 2019 um 01:19 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2019
Es dauert nicht lang, bis in diesem Buch ein ewig gültiges Statement zu lesen ist, das man über das von der Autorin behandelte Thema hinaus erweitern kann. Agnieszka Zagozdzon schreibt: »Am Ende meiner Arbeit [wurde deutlich], dass die musikalische Inszenierung des historischen Broadway-Sounds ein Mittel zur Erschaffung einer ganz bestimmten Form der fiktiven soziogeschichtlichen Vergangenheit – nicht nur von Broadway-Musicals – darstellte, da die Orchestratoren, insbesondere im Fall von amerikanischen Rezipienten, ganz gezielt mit hypothetischen Szenarien der Wiedererkennung, Assoziation und Verbindung stilistischer, memorialer und dramaturgischer Elemente im Rezeptionsprozess rechnen konnten und sie auch gezielt bedienten.« Wenn also in der Juli-Ausgabe der österreichischen Monatszeitschrift »Bühne« im Vorspann eines Artikels steht: »Das Broadway-Musical Carmen feiert […] beim Musicalsommer Winzendorf […] seine spektakuläre, deutschsprachige Erstaufführung«, ist das nicht einfach ein Tippfehler. Mit der Bezeichnung »Broadway-Musical« wollte der Autor ebenfalls auf eine Vergangenheit (die dieses Musical nicht hat) anspielen, die dem besprochenen Werk etwas mehr Glitter und Glanz verliehen haben würde. Im Fall von Frank Wildhorn ist das indes abstrus. Sein Background sind eigentlich die Pop-Charts, die Bedeutung des Great White Way stellt er in Interviews stets infrage. Aber das ist eben die Art und Weise, wie der Begriff »Broadway« im deutschen Sprachraum nicht selten eingesetzt wird.
Zurück zum Anfang. Anhand dreier Musicals analysiert die Autorin, mit welcher Absicht der klassische Broadway-Sound in Produktionen des späten 20. Jahrhunderts eingesetzt wird. Sie isoliert drei Strategien 1. »re-creation« (»Crazy For You«, 1992), 2. »imitation« (»42nd Street«, 1980) und 3. »glorification« (»Follies«, 1971). Zagozdzons präzise musiktheoretische und klangdramaturgische Analyse der orchestrierten Partituren bzw. der Piano-Conductor-Scores basiert auf reicher Sekundärliteratur. Es hat ein bisschen etwas von Cold-Case-Atmosphäre, mitzuverfolgen, wie die Autorin die Motive der Orchestratoren freilegt, warum diese auf welche Art und Weise den Classical-Sound kreiert haben, und was für Hintergründe sie im Zuge ihrer Untersuchung aufdeckt.
Fun Fact am Rande: In einer Fußnote steht zu lesen: »Es fanden sich keine Hinweise darauf, dass es jemals Orchestratorinnen am Broadway gegeben hatte.«
Ein musikhistorischer Thriller.
Agnieszka Zagozdzon: Von »re-creation« bis »glorification«. Zur musikalischen Inszenierung des historischen Broadway-Sounds in amerikanischen Musicals des späten 20. Jahrhunderts. Waxmann, Münster 2019. 234 Seiten. ISBN 978-3-8309-3909-4. € 34,90. waxmann.com
Martin Bruny am Freitag, den
25. Oktober 2019 um 01:16 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2019
2017 gegründet, hat sich die Buchreihe »Musical Theater Today« mittlerweile etabliert. Auch der dritte Band bietet einen Mix aus topaktuellen Features und interessant ausgewählten Hintergrundinterviews. Etwa zum Dauerbrenner-Thema: der Kritiker und das Theater. Shoshana Greenberg befragte dazu sechs bekannte Journalisten: Jesse Green und Elisabeth Vincentelli (New York Times), Diep Tran (American Theatre Magazine), Naveen Kumar (towerload.com), Terry Teachout (The Wall Street Journal) und Jose Solis (stagebuddy.com). Zum Beispiel zu ihrer Qualifikation: Haben die Autoren einen musikalischen Background? Wenn ja, wie hilft ihnen dieser bei ihrer Arbeit bzw. wie gehen sie an Kritiken heran, falls sie über keinen verfügen? Können die Befragten Noten lesen? Inwiefern ist das von Bedeutung? Welchen Stellenwert nimmt die Musik in ihren Kritiken ein, wie oft beurteilen sie Darsteller danach, ob deren Stimme für eine Rolle geeignet ist. Welche Bedeutung haben Kritiker für das Theater, welche Verantwortung spüren sie für das Genre, den Produktionen gegenüber, über die sie schreiben, und gegenüber dem Publikum. Aufschlussreiche 18 Seiten.
Der rote Faden, der sich durch den dritten Band der Reihe zieht, ist das Thema Orchestrierung. Unter dem Motto »Orchestration Today« bietet der Band Gespräche mit Komponisten, Instrumentalisten, musikalischen Direktoren und Arrangeuren. Ada Westfall spricht über den Conductor Score von »Times Square« (Sobule & Eaton) und erklärt anhand konkreter Notenbeispiele seine Herangehensweise ans Orchestrieren und Arrangieren: »My relationship to written music is such that I already feel like I’m in this forest that I belong in, you know? So, I’m always like, Well, if I’m here, I’m just going to fuck the rules and do whatever. So yeah. it often ends up being all highlighter and tape.« Michael Starobin zeigt im Detail seine Arbeit an dem Song »Exiled« aus dem Musical »Renascence« (Carmel Dean), dessen Cast-CD im kommenden Winter erscheinen wird. Dave Malloy analysiert einen Ausschnitt aus seinem Stück »Beardo« (Untertitel: Royalty, peasantry, sex, dirt, grandeur and hemophilia) und spricht über die Fallstricke bei seiner Arbeit: »… this is so dumb but I feel like I’m surprised by octaves all the time. I feel like I’m constantly writing something for clarinet and they’ll be like, Well, here’s what it sounds like in this octave, and I’ll be like, Oh right! And some of that is about being a piano player, because on the piano the octaves are laid out in such a democratic way. No octave is really better in a piano … but on a clarinet certain octaves are just so different.« Weitere Interviewpartner: Nadia DiGiallnardo (Music Supervisor, Co-Orchestration bei »Waitress«), Daniel Kluger (Komponist, Produzent, Sound Designer) Mike Brun & Shania Taub, die über die Arbeit an ihrem gemeinsamen Projekt »Twelth Night« im Central Park berichten, und Kris Kukul (Underscore für »Beetlejuice«). Weiters gibt es eine Fülle an hochinteressanten Artikeln zu Nischenthemen, etwa »Doing Broadway’s Laundry since 1908« (ein Interview mit Bruce und Sarah Barish, deren in der Bronx angesiedelte Firma Ernest Winzer Cleaners seit Jahrzehnten die Wäschereinigung der Broadway-Theater besorgt. 2018 wurden sie dafür mit einem Spezial-Tony-Award ausgezeichnet) oder ein Feature zum Thema Bootlegs. Eine wahre Freude, diese Buchreihe.
Musical Theater Today. The Anthology of Contemporary Musical Theater. Vol. 3. Yonkers International Press, Milton Keynes 2019. 456 Seiten. ISBN 978-0-36-8727337. $ 35,00. yonkersinternational.press
Martin Bruny am Samstag, den
5. Oktober 2019 um 01:14 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2019
2019 feiert die Rockoper »Tommy« ihr 50-jähriges Jubiläum. Am 23. Mai 1969 kam das Konzeptalbum von The Who in die Läden. Rechtzeitig zum runden Geburtstag erschien eine Biografie des Leadsängers der Band, Roger Daltrey (75), in deutscher Übersetzung. Er schildert darin einfach und geradlinig sein Leben und seine Karriere. Wobei das nicht abwertend gemeint ist. Hier wirkt vieles unbehauen, ungeschönt, die deutsche Übersetzung greift zu umgangssprachlichen Formulierungen, was diesen Eindruck aus dem Englischen ins Deutsche schwingt. Ehrlich, sympathisch, direkt schildert der Rocker etwa die Eskapaden der jungen The Who 1968 bei einer Australien-Tour: »Die gesamte Tour war ein Desaster. Der Sound katastrophal. Ich konnte nichts hören. Das Equipment war erstens beschissen und zweitens geliehen, sodass niemand erfreut war, als wir die Anlage zertrümmerten, was wir taten, weil sie beschissen war. Die Presse hatte es auf uns abgesehen, weil wir jung und britisch waren, lange Haare und ein schmutziges Mundwerk hatten und ihre Töchter vögelten.« Daltrey lässt durch seine grobe Skizzierung Freiräume für Interpretation. Etwa wenn er erklärt, was The Who von The Beatles unterschied: »The Beatles waren eine kleine Vier-Mann-Band in der Mitte eines Stadiums gewesen, lächerlich, aber wegen der Hysterie hat es funktioniert. Wenn die Mädchen aufgehört hätten zu kreischen, wären es bloß vier Wichte gewesen, die nicht besonders viel machten. Wir konnten uns nicht hinter Hysterie verstecken, also mussten wir mehr tun. Wir mussten das Stadion ausfüllen. Und dabei konnten wir uns nicht auf Großleinwände verlassen, weil es die noch nicht gab. Wir hatten bloß die Lichter und den Sound.« Sehr schön lässt sich das auf den Unterschied zwischen Rockshow und Musical anwenden. Nur wenn der Sound und Darsteller passen, funktionieren Rockmusicals. Zu oft erlebt man gerade bei »Tommy« »kleine Männchen in der Mitte einer Bühne«, schwachbrüstigen Sound, aber mit vielen Leinwänden und Projektionen, die inflationär eingesetzt werden.
Spannend sind die Passagen des Buches, in denen Daltrey die Entstehungsgeschichte von »Tommy« malt und deftige Anekdoten erzählt: »Es war Keiths Idee, Tommy am Ende in ein Ferienlager zu schicken. Das basierte auf einem sehr schwarzen Witz jener Zeit. Das Konzentrationslager – ein Urlaub, der ewig dauert. Meine Entschuldigung an meine jüdischen Freunde für unser mangelndes Mitgefühl, aber so war der Humor damals. Heute würde man damit nicht mehr durchkommen. Heute würde man mit der ganzen Geschichte nicht mehr durchkommen. Wir ließen ihn einfach machen. […] Erst als wir das Puzzle zusammengesetzt hatten, erkannten wir das vollständige Bild. Und nicht einmal dann war es ein besonders klares Bild, oder? Einige der Songs passen einfach nicht in die Handlung. Trotzdem behaupte ich, dass ‚Tommy‘, wenn man es von vorn bis hinten abspielt, bis heute vollkommen ist. Es ist wundervoll. Diese Schlichtheit. Die Kraft der Texte.«
Als The Who 1969 mit »Tommy« auf Tour gingen, war Daltrey 25 Jahre alt. Über die Reaktionen auf eine Präsentation vor Journalisten schreibt der Sänger: »Die Leute verließen den Laden mit dröhnenden Ohren. Keiner wusste, was ihm widerfahren war.« Doch die Band war nur scheinbar weit davon entfernt, Kult beziehungsweise durchschlagend erfolgreich zu sein. Daltrey wusste instinktiv, was das Erfolgsrezept sein würde: »Im Gegensatz zu allen anderen Bands hatten The Who einen Bassisten, der spielte wie ein Leadgitarrist, einen Gitarristen, der spielte wie ein Drummer, und einen Drummer, der die komplette Partitur mitspielte, alles außer einem geraden Vier-Viertel-Takt. Ich hatte mich auch körperlich verändert. Ich gab den Charakterdarsteller und hatte in meinem stimmlichen Ausdruck und meinen Bewegungen absolute Freiheit.« Die Liveshows wurden mit den Monaten intensiver, »Tommy« landete in den US-Album-Charts auf Platz 5, und dann kam er, der große Durchbruch. Daltrey: »Wir mussten nach Woodstock. Ich sage, wir mussten, denn obwohl das Festival als ein grundlegender Moment der Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen ist, war es kein großes Vergnügen.« Chaos, Drogen, 15 Stunden Wartezeit bis zum Start ihres Gigs – fast poetisch wirkt die rohe Kraft Daltreys Schilderungen eines der größten Momente der Bandgeschichte: »Backstage gab es nichts zu essen. Alles war mit LSD versetzt. Sogar die Eiswürfel waren manipuliert. Zum Glück hatte ich meine eigene Flasche Southern Comfort mitgebracht, sodass ich keine Probleme hatte, bis ich mich entschied, eine Tasse Tee zu trinken. Damit haben sie mich gekriegt. Mit einem netten Tässchen halluzinogenem Tee. […] Als wir dann um kurz nach sechs [Uhr morgens] zu ‚See Me, Feel Me‘ aus ‚Tommy‘ kamen, ging die verdammte Sonne auf. Nach dem ganzen Mist, den wir durchgemacht hatten, war es perfekt.« Ende 1969, wenige Monate nach Woodstock, waren The Who, so Daltrey »die größte Rock’n’Roll-Band der Welt«.
Ausführlich widmet sich der Rocker seiner Filmkarriere. Unterhaltsame Szenen bringt er von den Dreharbeiten zur Filmversion von »Tommy« (1975): »So verbrachte ich etwa einen ganzen Tag zwischen Tina Turners Beinen auf dem Boden liegend, während sie die Hüften schwenkte und kreisen ließ. Ich war seit Jahren ein Riesenfan von ihr, doch ich kann mich beim besten Willen an nichts erinnern. Ich könnte nicht mal sagen, welche Farbe ihr Slip hatte oder ob sie überhaupt einen trug. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr gesprochen habe. Tina Turner. Einen ganzen Tag lang. Nichts. Ich muss der größte Method Actor aller Zeiten sein.«
Über die Musicalversion (Premiere 1992) von »Tommy« findet man im Buch des Sängers nichts, was nicht verwundert, weil The Who »Tommy« primär als Album-Projekt betrachtet haben und schon bei der Verfilmung zögerlich waren. Dafür erfährt man einiges über die Entstehungsgeschichte der Rockoper »Quadrophenia«, mit der The Who auch 2019 auf Tour sind – ein zeitloses Werk. Daltrey: »Man kann heute sechzehn oder siebzehn sein, sich ‚Quadrophenia‘ anhören und glauben, die Texte würden direkt zu einem sprechen. Das sehe ich heute, wenn ich auftrete. Es gibt jede Menge alter Knacker, die mitrocken, wie sie es seit einem halben Jahrhundert tun. Aber ihre Enkel sind auch da. Und sie flippen total aus.« Ein starkes Buch.
Roger Daltrey: My Generation. Die Autobiografie. C. Bertelsmann 2019. 384 S.; (Hardcover) ISBN 978-3570103692. € 24,00. cbertelsmann.de
Martin Bruny am Montag, den
5. August 2019 um 01:09 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2019
Mitunter erlebt man auf der Musicalbühne Situationen wie die folgende. Zwei Darsteller sitzen an einem Tisch, jeder eine offensichtlich leere Kaffeetasse vor sich. Die Kaffeehäferl sind nicht aus Porzellan, sondern aus Plastik. Sie könnten ja auf den Boden fallen, dann hätten wir den Salat bzw. die Scherben. Zu gefährlich. Es wird eifrig in den leeren Tassen gerührt, dann aus ihnen »getrunken«. Ein bisschen Behauptung auf der Bühne muss sein. Doch die Szene mag noch so behauptet gestellt sein: Kaffeetrinken schafft auf der Bühne eine gewisse Atmosphäre, kann etwas über die Darsteller aussagen, die Handlung vorantreiben, ein völlig unsinniger Song über Kaffee könnte die Zeit einer Umbaupause überbrücken. Momente dieser Art können als Metapher eingesetzt werden, als Witz, Symbol. Sie können angelegt werden, um Empathie auszulösen, Erheiterung oder um das Publikum zu schockieren. Nicht zu vergessen: Kommt tatsächliches Essen ins Spiel, frisch gekocht, heiß aus dem Ofen, von der Herdplatte, spielt die olfaktorische Sensation eine Rolle, abhängig von der Größe des Theaters. Allerdings: Wie ausgeklügelt ein Regisseur, ein Autor sich das, sagen wir, 1960 für die Uraufführung auch ausgedacht haben, was sie alles damit aussagen wollten … Kommt die Show 2019 auf die Bühne, fällt der Kaffee in einer neuen Inszenierung vielleicht einem Strich zum Opfer, den Kaffeesong braucht man nicht, die Choreografie wird neu gemacht (das Ensemble schafft keinen Fosse) … Oder, schlimmer, die einst durchdachte Symbolik wird im Sinne der Jetztzeit neu interpretiert, es wird eventuell versucht, den Einsatz eines bestimmten Nahrungsmittels von der Bedeutung, die es in einer ganz anderen Kultur hatte, in die eigene zu übertragen …
Essen im Theater also. Ein Nischenthema, dem sich die Autorin Jennifer Packard im vorliegenden Buch mit großer Erzählfreude widmet. Seit fast 20 Jahren ist sie in der Nahrungsmittelindustrie tätig, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Harvard University und als freie Autorin zum Thema Nahrung. Die im Buch abgedruckte Kurzbiografie schließt typisch amerikanisch: »Jennifer loves to make up new recipes which she tests out on her husband and three teen-aged sons.«
Für Packard war »Fiddler on the Roof« der Ausgangspunkt, an ein Buchprojekt zu denken: »While rewatching [it] I began thinking about Tevye’s dairy business, Golde’s preparation of the Sabbath dinner, and Lazar Wolf’s role as a butcher. As a food scholar, I could not help but contemplate what the menu would have looked like in the daily lives of these characters. As I started reviewing musicals with food in mind, I noticed several recurring themes in how food was used as a communication vehicle. These themes are represented as chapters in this book. Each chapter examines, show by show, how food is used in musical theater. Each section looks at the meaning of food in the context of the show, the link between food and the show’s creators, and how particular foods fit into the world beyond the stage.«
In acht Kapitel hat die Autorin ihr Buch gegliedert: »Food to Set the Scene«, »Regional Foods«, »Food as Identity«, »Explaining Characters and Relationships through Food«, »Just Trying to Put Food on the Table«, »Food as Class«, »The Way to a Man’s (or Woman’s) Heart«. Dabei lernt man Shows wie »Pacific Overtures«, »The Music Man«, »Carousel«, »Fiddler on the Roof«, »The Producers«, »Hair«, »Gypsy«, »Grease«, »Hairspray«, »Hello, Dolly!«, »Waitress« u. v. a auf eine ganz eigene Art und Weise neu kennen.
Greifen wir aus der Vielzahl der besprochenen Shows eine besonders beliebte heraus: »Les Misà©rables«. Essen steht am Anfang und Ende. Jean Valjean hatte einen Laib Brot gestohlen, um das hungernde Kind seiner Schwester zu füttern. »Working back from the opening scene set in 1815, Valjean’s original attempt to steal bread would have taken place in 1796. At this time, France was still in the midst of revolution. The government controlled the price of bread until the 1790s, but by 1796, the price controls had been removed and the populace was at the mercy of the market. The government attempted to subsidize the price of bread for the poor, but bread prices and the number of indigent people continued to rise steeply. Bread shortages, high food prices, and a rising level of poverty led to food riots and starvation.« Am Ende des Abends steht eine prachtvolle Hochzeit, mit Tischen, die sich vor Essen biegen. Ausgehend von diesem Setting holt Packard die Thematik in unsere Zeit. »In 2011, a homeless man in Genoa was arrested for attempting to steal sausage and cheese from a supermarket. The man was fined € 100 and sentenced to six months in jail. After an appeal by the general prosecutor, the Italian government ruled that it was not a crime to steal a small amount of food out of necessity.« Sie begibt sich auf Spurensuche. Welches Brot mag man damals gegessen haben, welches Mehl konnte man sich leisten? Hochinteressante Details bringt sie ins Spiel. Welche Bedeutung messen handelnde Figuren, etwa Javert, Brot zu, wie kommt das im »Work Song« zum Ausdruck? Zum Abschluss bietet sie Rezepte, zum Beispiel »Jean Valjean’s Stolen Loaf« – eine Nahrungsmittelrekonstruktion. Fazit von Packard: »Despite Valjean’s lifelong struggles, he manages to fulfill his promise to ensure that Cosette is fed and loved. The audience sees the characters going from starvation and hopelessness to feasting and fulfillment.«
Ganz am Ende des Buches fasst die Autorin dann noch einmal ihre Erkenntnisse über die Bedeutung von Essen auf der Musicalbühne zusammen und schließt mit dem Satz: »Breaking bread together has always been a special way to build and celebrate relationships. As characters onstage break bread together, the audience is right there with them, vicarious participants in the meal. Food not only brings characters together but also joins the cast, crew, and audience in a delicious shared experience. Together, they enjoy a taste of Broadway.«
Jennifer Packard: A taste of Broadway. Food in musical theater. Rowman & Littlefield, Lanham 2018. 202 S.; (Hardcover) ISBN 978-1442267312. $36,66. rowman.com
Martin Bruny am Mittwoch, den
3. April 2019 um 01:24 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2019
Ein Phänomen gibt es in der österreichischen Medienlandschaft zu beobachten: Wann immer die Rede auf »Sound of Music« kommt, platzieren Journalisten in schöner Regelmäßigkeit an prominenter Stelle ihres Artikels den Hinweis, dass »das« etwas sei, was man ja in Österreich kaum kenne. Mit »das« meinen sie dann manchmal die Musicalverfilmung aus dem Jahr 1965, aber genauso das Broadway-Musical aus dem Jahr 1959. Der letzte Artikel aus dieser Riege stammt vom 2. Juni 2018, trägt den Titel »Warum Sound of Music in Österreich keiner kennt« und ist in der österreichischen Tageszeitung »Kurier« erschienen. Freilich ist es absurd, heutzutage noch derartige Klischees in Artikeln zu verbraten. Man bezieht sich auf einen Zustand von vor 20, 30 Jahren und muss unterscheiden: Heute zu fragen, warum niemand das US-Bühnenmusical kennt, ist ein Zeichen von Unkenntnis. Das kennen schlicht so wenige, weil in der Tat gar nicht so viele Menschen sich Musicals ansehen. Alle, die es sehen wollen, haben aber seit etlichen Jahren Gelegenheit dazu, sei es in Wien oder in Salzburg. Eine Produktion im Wiener Schauspielhaus ging etwa bereits 1993 über die Bühne.
Zu fragen, warum der US-Film, den weltweit bislang etwa zwei Milliarden Menschen gesehen haben, in Österreich nicht so populär ist wie in den USA ergibt schon mehr Sinn. Dafür existiert eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen. Zum Beispiel jener, dass es ja zum Thema Trapp den enorm populären deutschen Film »Die Trapp-Familie« (zwei Millionen Kinobesucher in Deutschland und Österreich) aus dem Jahr 1956 gibt. Und abgesehen davon wird, wie die Geschichte zeigt, eben nicht jede Musicalverfilmung in jedem Land gleich populär. Es gibt weitere Thesen, und wenn man vorliegendes Buch gelesen hat, kann man sie, auf Fakten basierend, besser beurteilen.
Die Juristen und Sachbuchautoren Birgit Mosser-Schuöcker und Gerhard Jelinek gestalten unter anderem regelmäßig Dokus für den ORF, so 2017 »The Sound of Austria. Die Geschichte der Trapp-Familie«. Ende 2018 lieferten sie auch in Buchform eine Fülle von Background-Stories rund um die beliebte Familie Trapp. Mosser-Schuöcker führt in jedes Kapitel im Drehbuchstil ein, lässt so die Szenerie, in der der jeweilige Abschnitt spielt, lebendig werden. Das verleiht dem Buch eine fesselnde Unmittelbarkeit. Wer sich schon näher mit der Familie Trapp beschäftigt hat, wird einiges kennen, etwa die hochinteressanten Facts Georg von Trapp betreffend. Mosser-Schuöcker schildert im Intro dieses Kapitels die entscheidenden Szenen vom 27. April 1915, als Trapp, damals 35 und Kommandant des Torpedoboots S.M.U. »5«, im Rahmen einer insgesamt sechstägigen Feindfahrt vor Santa Maria de Leuca den französischen Panzerkreuzer »Là©on Gambetta« versenkte. 821 Mann waren an Bord des Kreuzers, 684 davon starben. Im Kapitel selbst wird die Karriere des Trapp-Vaters anhand von Facts aufbereitet. Zeitungsartikel, Material aus Archiven, Zitate aus Büchern. Journalistisch einwandfrei.
Was die Kapitel über das Musical und die Musicalverfilmung unter anderem so interessant macht, sind Interviews mit Zeitzeugen. Oder einfach verblüffende Fakten. So erhalten die Trapps auch heute noch, mehr als 50 Jahre nach der Premiere des Musicals, geschätzte 100.000 Dollar pro Jahr an Tantiemen. Ende 1957 stimmten alle Familienglieder einer vertraglichen Vereinbarung zu, Maria Trapp erhielt drei Achtel eines Prozents aller Einnahmen. Der Aufteilungsschlüssel (auch für die Filmrechte) gilt bis heute.
Eine weitere These, warum die Musicalverfilmung in Österreich nie durchschlagenden Erfolg hatte, kann man aus folgender Passage des Buches ableiten: Franz Wasner, der Neffe jenes gleichnamigen katholischen Geistlichen, der als Chorleiter die singende Trapp-Familie zu einem Chor formte (und weder im Broadway-Musical noch im US-Film, wohl aber in der deutschen Verfilmung, da verkörpert von Josef Meinrad, eine Rolle spielte), meinte in einem Interview: »Ich kann mir vorstellen, warum der Film in den Vereinigten Staaten so ein Erfolg ist und in Österreich weniger. Weil er eine typisch amerikanische Geschichte erzählt. Es geht dabei um Einwanderer, und praktisch jeder Amerikaner hat irgendwo in seiner Vergangenheit in der zweiten, dritten Generation selbst die Geschichte, zugewandert zu sein, während die Österreicher sich weniger mit dem Film identifizieren können. Wie viel Prozent ist denn gelungen, vor den Nationalsozialisten auch wegzukommen. Ganz wenigen.«
Aber auch folgendes Zitat liefert eine mögliche Erklärung: »Signifikant ist die Anschlusss-Szene, in der ein Trupp Wehrmachtssoldaten (unbewaffnet) über den Residenzplatz marschiert. Ein Regieassistent erinnert sich daran, dass sich die Dreharbeiten zu dieser Zeit schwierig gestaltet haben. Der Stadtverwaltung waren die Nazi-Flaggen unangenehm, schließlich lag das Kriegsende erst 20 Jahre zurück. Man bestand darauf, dass die deutschen Soldaten keine Waffen tragen und die Salzburger (anders als in der Realität) nicht jubeln, sondern unbeteiligt herumstehen. Dem Vernehmen nach soll erst die Drohung, echtes Archivmaterial aus den Märztagen zu verwenden, die Drehgenehmigung erwirkt haben.« Ja, so ist es eben, wenn eine Nation mit der Aufarbeitung der Nazi-Ära noch lange nicht fertig ist und mit der Aufarbeitung der Nachkriegsära noch gar nicht begonnen hat. Das war ja auch schon ein mögliches Erklärungsmuster, warum »The Producers« im Wiener Ronacher eine derartige Bauchlandung hingelegt hat. Letztendlich, so die Autoren, könnten es aber auch simple ökonomische Gründe gewesen sein. Mitte der 1960er-Jahre begannen die Kinos in Österreich die TV-Konkurrenz zu spüren. Zeitungen schrieben vom »Kinosterben«. Fazit: Eine empfehlenswerte Spurensuche.
Gerhard Jelinek, Birgit Mosser-Schuöcker: Die Trapp-Familie. Die wahre Geschichte hinter dem Welterfolg. Molden, Wien/Graz/Klagenfurt 2018. 256 S.; (Hardcover) ISBN 978-3-222-15026-5. EUR 26,–. styriabooks.com
Bücher-News Februar/März 2019
Bell-Metereau, Rebecca: Transgender Cinema. Rutgers University Press, New Jersey 2019. 130 Seiten. (Hardcover) ISBN 978-0813597348. $ 65,00
Donnelly, Kevin J. (Hg.); Carroll, Beth (Hg.): Contemporary Musical Film. Edinburgh University Press, Edinburgh 2019. 208 Seiten. (Paperback) ISBN 978-1474431682. $ 29,95
McGilligan, Patrick: Funny Man – Mel Brooks. Harper, New York 2019. 640 Seiten. (Hardcover) ISBN 978-0062560995. $ 40,00
Osatinski, Amy: Disney Theatrical Productions – Producing Broadway Musicals the Disney Way. Routledge, New York 2019. 220 Seiten. (Paperback) ISBN 978-0367086121. $ 150,00
Propst, Andy: They Made Us Happy – Betty Comden & Adolph Green’s Musicals & Movies. Oxford University Press, Oxford 2019. 288 Seiten. (Hardcover) ISBN 978-0190630935. $ 34,95
Rogers Schwartzreich, Amy: The Ultimate Musical Theater College Audition Guide. Advice from the People Who Make the Decisions. Oxford University Press, Oxford 2019. 208 Seiten. (Hardcover) ISBN 978-0190925048. $ 99,00
Tietjen, Jill; Bridges, Barbara: Hollywood – Her Story, An Illustrated History of Women and the Movies. Lyons Press, Guilford 2019. 400 Seiten (Hardcover) ISBN 978-1493037056. $ 35,00
Van Leuven, Holly: Ray Bolger – More than a Scarecrow. Oxford University Press, Oxford 2019. 256 Seiten. (Hardcover) ISBN 978-0190639044. $ 29,95
Vansant, Jacqueline: Austria Made in Hollywood, Camden House, Rochester 2019. 208 Seiten. (Hardcover) ISBN 978-1571139450. $90.00
Vaughan, Hunter: Hollywood’s Dirtiest Secret: The Hidden Environmental Costs of the Movies. Columbia University Press, New York 2019. 256 Seiten (Hardcover) ISBN 978-0231182416. $ 90,00
« zurueck ·
vor »
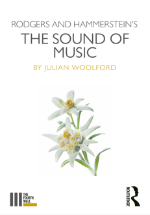 22 Titel umfasst die Buchserie »The Fourth Wall«, die der Verlag Routledge 2016 mit einem Band zu Harold Pinters »Party Time« startete. Der Verlag charakterisiert die Reihe folgendermaßen: »Fourth Wall books are short, accessible accounts of some of modern theatre’s best loved works. They take a subjective but easily digestible approach to their topics, allowing their authors the opportunity to explore their chosen subject in a way that is absorbing enough to be of use both to lovers of theatre and those who are being asked to study a play more deeply. Each book in the series looks at a specific play, variously exploring its themes, contexts and characteristics while prioritising original, insightful writing over complexity or scholarly weight.« Acht Bände widmen sich Musicals: »My Fair Lady«, »Sunday Afternoon«, »Into the Woods«, »Sweeney Todd«, »Les Misà©rables«, »Hedwig and the Angry Inch«, »The Book of Mormon« und, 2020 erschienen: »The Sound of Music«.
22 Titel umfasst die Buchserie »The Fourth Wall«, die der Verlag Routledge 2016 mit einem Band zu Harold Pinters »Party Time« startete. Der Verlag charakterisiert die Reihe folgendermaßen: »Fourth Wall books are short, accessible accounts of some of modern theatre’s best loved works. They take a subjective but easily digestible approach to their topics, allowing their authors the opportunity to explore their chosen subject in a way that is absorbing enough to be of use both to lovers of theatre and those who are being asked to study a play more deeply. Each book in the series looks at a specific play, variously exploring its themes, contexts and characteristics while prioritising original, insightful writing over complexity or scholarly weight.« Acht Bände widmen sich Musicals: »My Fair Lady«, »Sunday Afternoon«, »Into the Woods«, »Sweeney Todd«, »Les Misà©rables«, »Hedwig and the Angry Inch«, »The Book of Mormon« und, 2020 erschienen: »The Sound of Music«.



 Deutschland 1932. Die Brüder Peter und Alfred Rotter bespielen neun Theater: das Metropol-Theater (dessen Kern in der heutigen Komischen Oper erhalten geblieben ist), das Theater des Westens, das Lessing-Theater, den Admiralspalast, Lustspielhaus, Zentraltheater Berlin, Zentraltheater Dresden, Alberttheater Dresden, Mellini-Theater Hannover. Für Komödien und Dramen haben sie auch noch das Deutsche Künstlertheater und das Theater in der Stresemannstraße (heute: Hebbel am Ufer) in ihrem Portefeuille. Und die Plaza in Friedrichshain mit 3000 Sitzplätzen. Sie manövrieren mit Wagemut zwischen Erfolg und Bankrott, mitten in der Wirtschaftskrise.
Deutschland 1932. Die Brüder Peter und Alfred Rotter bespielen neun Theater: das Metropol-Theater (dessen Kern in der heutigen Komischen Oper erhalten geblieben ist), das Theater des Westens, das Lessing-Theater, den Admiralspalast, Lustspielhaus, Zentraltheater Berlin, Zentraltheater Dresden, Alberttheater Dresden, Mellini-Theater Hannover. Für Komödien und Dramen haben sie auch noch das Deutsche Künstlertheater und das Theater in der Stresemannstraße (heute: Hebbel am Ufer) in ihrem Portefeuille. Und die Plaza in Friedrichshain mit 3000 Sitzplätzen. Sie manövrieren mit Wagemut zwischen Erfolg und Bankrott, mitten in der Wirtschaftskrise. Dan Dietz hat wieder zugeschlagen und seine 2014 gestartete, erfolgreiche Buchserie »The Complete Book of … Broadway Musicals« ergänzt – sie liegt nun von den 1920er- bis zu den 2000er-Jahren geschlossen vor. Wer alle neun Bände erworben hat, verfügt über ein Werk von 5088 Seiten zu einem Preis von rund 1300 US-Dollar.
Dan Dietz hat wieder zugeschlagen und seine 2014 gestartete, erfolgreiche Buchserie »The Complete Book of … Broadway Musicals« ergänzt – sie liegt nun von den 1920er- bis zu den 2000er-Jahren geschlossen vor. Wer alle neun Bände erworben hat, verfügt über ein Werk von 5088 Seiten zu einem Preis von rund 1300 US-Dollar.

