Archiv - Rezensionen
Martin Bruny am Sonntag, den
10. Juni 2018 um 14:18 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Theater, 2018
Da stand ich also im Schlosspark in Kottingbrunn und musste laut lachen. Eben hatte ich im Programmheft eines Konzerts, das ich gleich besuchen würde, die programmatischen Richtlinien der Veranstaltung gelesen. Ein paar Wochen vorher hatte ich »Musical Unplugged« noch als »Hochamt der gepflegten Musicalparodie« angekündigt, nun hatte ich gelesen: »Man verzichtet auf jegliche Angriffe gegen Politik, Gesellschaft, Theaterproduktionen, Sängerkollegen usw. … und man bedient die Lieder mit Eigenironie.« Gegen dieses Konzept ist an sich nichts zu sagen, kann man machen. Solche Konzerte gibt es viele, man reiht sich damit in eine Reihe an typischen Veranstaltungen ein. Das Problem ist, dass das Repertoire, das man in Konzerten dieser Art hört, meist überschaubar ist. Als Veranstalter hofft man vermutlich auf zwei Zielgruppen: junge Musicalfans, die das eine oder andere Lied noch nicht kennen, für die etwa ein Mann wie Steve Barton eine Persönlichkeit aus der tiefsten Musicalsteinzeit ist. Die zweite Zielgruppe könnten Hardcore-Fans sein, die sich auch noch nach dem trillionsten Aufguss von »Tanz der Vampire« nicht langweilen. Hat man mich als Zielgruppe mitgemeint? Nicht unbedingt, aber es bleibt das Interesse an neuen Interpretationen (und auch an begabtem Musicalnachwuchs wie Lorenz Pojer und Moritz Mausser, die an diesem Abend Talentproben lieferten), auch wenn man das eine oder andere Lied nicht mehr hören kann. Das Problem mit der Eigenironie von Songs im typischen Musicalhits-Repertoire: Sie beschränkt sich bisweilen darauf, dass sie schlecht übersetzt wurden oder recht simpel gestrickt sind.
Wie auch immer. Wie konnte ich nur im Vorfeld »Musical Unplugged 11« so falsch einschätzen? Vor ein paar Jahren noch hatte ich ein Konzert aus dieser Serie als durchaus satirisch empfunden, da waren sehr wohl ein paar witzige Salven in Richtung VBW unterwegs gewesen. Gut, in der Zwischenzeit hat sich viel getan. Die Vereinigten Bühnen Wien haben die Musicallandschaft etwa mit einer »Revueoperette« (so der Regisseur Andreas Gergen) namens »I Am From Austria« gesegnet. Und wirklich jeder, dem ich erzählt habe, welcher Kategorie dieser Regisseur dieses Musical zugeordnet hat, musste zumindest lächeln. So blöd kann ein Tag gar nicht gelaufen sein, dass man da nicht zumindest lächelt. Lieder aus diesem Musical standen auch auf dem Programm von »Musical Unplugged« und zeigten tatsächlich überhaupt nicht ironisch, sondern ganz brutal, wie unsagbar dämlich »I Am From Austria«, das Musical, ist. Sie wirken nämlich nicht. Sie wirken nicht, wenn man sie in der Show im Raimund Theater hört, aufgefettet mit einem tranigen, schwülstigen Arrangement, sie wirken auch nicht in Musicalkonzerten. Da kann man sie so gut singen, wie man will, da kann sich Jakob Semotan, der ansonsten einen starken Abend hatte, noch so reinwerfen. Lieder von Rainhard Fendrich wirken dann, wenn Rainhard Fendrich sie singt. Zumindest für die Generation, die die Karriere von Fendrich und sein Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit miterlebt hat. Der Begriff Karaoke wäre vielleicht zu hart, aber Fendrichs Lieder nachzusingen, ist keine gute Idee. Hat denn jemals jemand Fendrich-Songs gecovert? Zumindest gab es den Versuch, aus dem Repertoire Fendrichs neben dem durch Struppeck & Co. vernichteten Bestand das eine oder andere Lied zu wählen, das sich eignet, gecovert zu werden. »Wart bis hamlich wird und stü« (gesungen von Florian Schützenhofer) kann man da als gelungenes Beispiel sehen.
Neben dem parodistischen Ansatz waren »Musical Unplugged«-Konzerte immer auch durch eine Mischung der Genres gekennzeichnet. Das hat sich nicht ganz geändert, auch wenn ich zumindest in Erinnerung habe, dass der Musicalanteil nicht immer ganz so dominant war. Immerhin, die Bandbreite reichte von Karl Hodina bis Konstantin Wecker und Leonard Cohen. Früher gab’s etwas originellere Einfälle und Umsetzungen aus dem Bereich der Kirchenmusik, aber das mag auch an den Vorlieben der musikalischen Leiter der einzelnen Veranstaltungen liegen.
Jetzt kommen wir zu Vermutungen. Warum mag das Parodistische scheinbar so in den Hintergrund getreten sein? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man »Kooperationen« mit den VBW nicht machen könnte, wenn man sie gleichzeitig zu sehr auf die Schaufel nimmt. Wir sollten alle mal das Humorpotenzial von Christian Struppeck abchecken. Oder halt, nicht nötig. Einfach mal in »I Am From Austria« gehen. Wenn also zwei Mitglieder der aktuellen VBW-Cast von »Tanz der Vampire« bei »Musical Unplugged« mitwirkten, könnte man sich vorstellen, dass der Faktor Parodie eher dezent ausfallen musste. Dafür, das muss man zugeben, lieferten Charles Kreische und Christoph Apfelbeck, begleitet vom Ein-Mann-Orchester Walter Lochmann, eine geblockte Power-Performance ab, die sich sehen und hören lassen konnte.»Carpe Noctem« (»Tanz der Vampire«), »Wer ich wirklich war« (»Tarzan«), »Heut ist der Tag« (»3 Musketiere«), »Draußen« (»Der Glöckner von Notre Dame«), »Schwert und Stein« (»Artus – Excalibur«) und »Die Schatten werden länger« (»Elisabeth«). Diese Batterie an konzentrierter MusicalManPower war beeindruckend. Das klappte auch deswegen, weil es funktionierende Songs aus gut konzipierten Musicals sind. Hat man Kreische und Apfelbeck gefragt, ob sie nicht auch noch ein Liedchen von Udo Jürgens schmettern möchten? Dann wäre es ihnen in dieser Show vielleicht wie Kai Peterson ergangen, der mit zwei Songs (»Freudiana« aus Freudiana und »Verona II« aus »Romeo & Julia«) beeindruckte – und dann noch »Immer wieder geht die Sonne auf« von Udo Jürgens gab inkl. Nonsens-Moves. So zerstört man nachhaltig Wirkung. War das parodistisch gemeint?
Was sich nicht am Konzept geändert hat, ist das Element, das man in New York jedes Jahr groß als eigenes »Broadway Backwards«-Event aufzieht, als Show, in der Männer ursprünglich für Frauen geschriebene Songs singen. Das hat bisweilen Humorpotenzial, klar. Musikalischen Witz steuerte zu »Musical Unplugged« der musikalische Leiter Walter Lochmann bei, etwa, wenn er das Lied »Never Ending Story« mit einer Phrase aus »Let It Be« von den Beatles einleitete und die Sängerin Denise Schrenzer nahtlos in Limahls Song überging. In einem Instrumental-Medley am Klavier spielte Lochmann dann ausgehend von Sylvester Levays »Jeder Abschied ist der Anfang einer Reise« Phrasen aus diversen (Musical-)Songs und kam immer wieder auf Levays Ausgangslied zurück. Er spielte auf Kompositionsähnlichkeiten an, zitierte aus dem »Phantom der Oper«, aus »Elisabeth«, variierte die Themen, ging zu Udo Jürgens und »Ich war noch niemals in New York« über, zu »New York, New York« von Kander/Ebb und einigem mehr. Lochmann könnte ohne großen Aufwand simple Kompositionstricks schärfer aufs Korn nehmen, aber wozu? Elegante Anspielungen reichen.
Fazit: Es ist längst an der Zeit, wieder in den Forbidden-Musical-Modus zu schalten, Stellung zu beziehen. Nicht mitzuspielen, bei der völligen Trivialisierung des Musicalgenres in Wien. Das wäre keine Stellungnahme gegen die VBW als Unternehmen, es wäre eine Stellungnahme gegen die aktuelle Leitung dieser Firma. Das ist legitim. Letzten Endes gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man kann den Quatsch hinnehmen, den man wohl noch jahrelang vorgesetzt bekommt, oder man kämpft dagegen an. Da bin ich doch eher für den Kampf, und sei es über den Weg des Humors und der Satire. Die ehemaligen Masterminds der Forbidden-Musical-Schiene wie Werner Sobotka hat das System längst geschluckt. Von ihnen ist vermutlich in der Richtung nichts mehr zu erwarten. Neue Leute sind gefragt. Dann kann man endlich wieder den Widerstand feiern, und zwar wie es in einem Song von Konstantin Wecker heißt, der ebenfalls bei »Musical Unplugged« gegeben wurde: »Freunde, rücken wir zusammen, denn es züngeln schon die Flammen, und die Dummheit macht sich wieder einmal breit.[…] Das wird ein Fest, ohne Marschmusik und Fahnen, ohne Waffen und Grenzen, lieber grenzenlos Wein.«
Martin Bruny am Montag, den
14. Mai 2018 um 02:25 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2018
Drei der fünf erfolgreichsten US-Kinofilme des Jahres 2017 stammen aus dem Hause Disney: Platz 1: »Star Wars: The Last Jedi«. Platz 2: »Beauty and the Beast« und Platz 4: »Guardians of the Galaxy. Vol. 2«. Stage Entertainment zeigt in Deutschland derzeit fünf Disney-Musicals. Eines davon, »The Lion King«, läuft bereits im 21. Jahr am Broadway und im 17. Jahr in Deutschland. John Wills unternimmt in seinem kleinen Reader der Reihe »Quick Takes« den Versuch, das Unternehmen Disney kritisch abzuklopfen. Er stellt provokante Fragen und mahnt zur Vorsicht. Indem man Kinder quasi mit Disney aufzieht, setzt man sie auch den Werten aus, die das Unternehmen, durchaus gewollt, transportiert. »The company has promoted a range of fundamental notions and ideals through its movies: universal love, good conquering evil, and simple happy endings. It also has also pushed a range of cultural and social values: a Protestant-style work ethic, absolute morality, and traditional family roles.« Er geht dabei zurück bis in die Gründungsphase von Disney Anfang der 1920er-Jahre und liefert spannende Storys über die Unternehmenskultur bei Disney, die im Wesentlichen auf strikten Geboten basiert. »Walt Disney corporate trainers explain, We don’t put people in Disney, we put Disney in people. Corporate culture employs techniques to strip away the self of employees and remake them as Disney cast members.« Für Wills liegt auf der Hand, dass Filme wie »Frozen« oder »The Lion King« Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, sie sind Teil der »Disneyfication of childhood«. Spannende Lektüre, die ein Ausgangspunkt für eine differenzierte Auseinandersetzung mit Disney sein kann. Auf 15 Seiten gibt es jede Menge Tipps zu weiterführender Lektüre.
John Wills: Disney Culture. Rutgers University Press, New Brunswick 2017. 160 S.; (Paperback) ISBN 978-0813583327. $ 17,95. rutgersuniversitypress.org
Martin Bruny am Donnerstag, den
10. Mai 2018 um 09:02 · gespeichert in West End, Musical, Rezensionen, Bücher, 2018
Der Schauspieler, Sänger und Autor Adrian Wright hat sich mit drei seiner Sachbücher, »Tanner’s Worth. Rediscovering The Post-War British Musical« (2010), »West End Broadway. The Golden Age of the American Musical in London« (2012) und dem vorliegenden Buch »Must Close Saturday« (2017), als Experte auf dem Gebiet der britischen Musicalgeschichte etabliert. Mit kleinen Einschränkungen. Diese Einschränkungen betreffen zum einen den Forschungsgegenstand an sich. Erst in den letzten Jahren ist ein verstärktes Interesse in England zu bemerken, die eigene Musicalgeschichte aufzuarbeiten. Da kann man sich natürlich etwas leichter als Autorität einen Namen machen. Die Einschränkung betrifft zweitens den Zugang, den Wright wählt, beziehungsweise seinen Background. Nicht selten wird bezüglich seiner Publikationen der Plauderton thematisiert, den er wählt, sein nicht-wissenschaftlicher Zugang zum Thema. Und ja, es finden sich in seinen Büchern immer wieder mal fachliche Fehler (falsche Daten, Verwechslungen, was Namen betrifft). Ja, sein Stil ist subjektiv, klar wertend. Aber wie schrieb einst Kurt Tucholsky: »Alles ist richtig, auch das Gegenteil. Nur zwar … aber, das ist nie richtig.« Insofern ist diese Art der subjektiven, populären Geschichtsbetrachtung legitim.
Fun Fact: Drei der von Wright besprochenen Flops waren bisher in Österreich zu sehen. In Amstetten lief 2001 als Österreichische Erstaufführung »Moby Dick«, ein Musical von Hereward Kaye und Robert Longdon, das 1992 in London auf 127 Vorstellungen kam. Im Wiener Raimund Theater brachte Kathi Zechner 2005 Gà©rard Presgurvics »Romà©o et Juliette « zur Aufführung. Die englischsprachige Version des vielleicht bisher erfolgreichsten französischen Musicals überhaupt mit mehr als sechs Millionen Besuchern weltweit stand 2002 in London nur 112 Mal am Spielplan. Und 2018 brachte das Landestheater Linz den West-End-Flop »Betty Blue Eyes« von George Stiles und Anthony Drewe auf die Bühne. In London schaffte die Show 2011 189 Vorstellungen.
Aber was ist eigentlich ein Flop? Adrian Wright definiert dies anhand der Anzahl der Aufführungen. Shows mit weniger als 250 Aufführungen fielen für sein Buch in die Kategorie »Flop«. In dem von ihm behandelten Zeitraum von 1960 bis 2016 (Flop-Musicals vor dieser Periode bespricht er in seinem Buch »Tanner’s Worth«) sind das rund 170 Produktionen. Eigentlich müsste man, wollte man besonders kritisch sein, hinterfragen, was Wright unter einem »british Musical« versteht, wenn er auch aus Frankreich stammende Musicals wie »Romà©o et Juliette « dazuzählt, aber er hat dafür ohnedies eine Erklärung parat: »Some shows that originated in other countries but were subsequently seen in London are included, generally when the West End production was significantly different from that seen elsewhere.« (Off-)Broadway-Shows, die in New York ihre Erstaufführung erlebten, hat Wright übrigens ausgeschlossen. Musicalgeschichte ist keine exakte Wissenschaft, das geht schon in Ordnung.
Die Megaflops unter den Flops könnte man isolieren. Vier Shows mit weniger als zehn Aufführungen gibt es im besprochenen Zeitraum: »Big Sin City« (Neil, Lea und John Heather, 1978, 6 Vorstellungen), »Call It Love?« (Sandy Wilson, Robert Tanitch; 1960, 5 Vorstellungen), »Joie De Vivre« (Robert Stolz, Paul Dehn, Terence Rattigan, 1960, 4 Vorstellungen), »Money To Burn« (Daniel Abineri, 2003, 2 Vorstellungen) und »Romance« (Charles Ross, John Spurling, 1971, 6 Vorstellungen).
Wrights System schließt nicht aus, dass langfristig betrachtet so mancher Hit des West Ends eigentlich auch als Flop kategorisiert werden könnte. Das Musical »Charlie Girl«, ab Mitte der 1960er-Jahre immerhin 2202 Mal am Spielplan und 1986 noch einmal für ein halbes Jahr, ist heute vergessen. Ist es als Hit oder Flop zu werten? Lionel Barts »Oliver!« erlebte am 10. Juni 1960 seine Uraufführung im Wimbledon Theatre. Die zweieinhalbwöchige Spielzeit erbrachte einen Verlust von 4500 Pfund. Impresario Donald Albery meinte damals: »I thought is was the biggest flop I’d ever had. All the backers tried to get out.« Am 30. Juni desselben Jahres stieg die Premiere der Show im New Theatre (dem heutigen Noà«l Coward Theatre) und lief dort 2618 Mal. Der Beginn einer Erfolgsstory.
Dass das Interesse der Briten daran, ihre Musicalgeschichte aufzuarbeiten, doch noch nicht, sagen wir: überbordend ist, könnte man einem Satz der Danksagung Wrights entnehmen, wenn er schreibt: »My main debt of gratitude must be to the staff of the Victoria and Albert Theatre and Performance Archive for their friendly and ever-willing assistance, even when they gazed mysteriously at what I had summoned from their vaults and said You are the only person that ever asks for this stuff.«
Wrights Buch ist eine Fundgrube an Fakten und Anekdoten zur britischen Musicalgeschichte, man bekommt Lust, im Web weiter zu recherchieren. Mit Bildmaterial geht er eher sparsam um, im Anhang bietet er ein Register der Showtitel und ein allgemeines Register, den Endnoten kann man viele Zeitschriften-Verweise entnehmen, die Bibliografie auf zwei Seiten ist recht knapp gehalten. Die Auflistung aller im Buch behandelten Produktionen mit Angaben zu Autoren/Komponisten, Ort der Aufführung, Hauptdarstellern, Songs und Anzahl der Aufführungen hätte man noch um Details zu Regisseur, Choreograf und weiteren Mitgliedern des Kreativteams ergänzen können. Aber es ist durchaus Pionierarbeit, die Wright hier leistet, und was noch viel schlimmer it: Man weiß nicht, ob noch Ausführlicheres nachkommt. Daher gilt für dieses wie auch die beiden anderen erwähnten Bücher des Autors: sehr empfehlenswert.
Adrian Wright: Must Close Saturday. The decline and Fall of the British Musical Flop. The Boydell Press, Woodbridge 2017. 352 S.; (Hardcover) ISBN 978-178327. £ 25.00. boydellandbrewer.com
Martin Bruny am Dienstag, den
10. April 2018 um 02:18 · gespeichert in Rezensionen, 2018
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts, gespiegelt in 99 für diesen Zeitraum essenziellen Songs, was »gesellschaftliche Hintergründe, kollektive Sehnsüchte oder Konsumentwicklungen und Zeitbrüche« betrifft, versucht der Journalist und ehemalige Direktor des Wien Museums, Wolfgang Kos, in seinem neuen Buch zu skizzieren. Mit dabei jede Menge Musicalsongs. Jede Menge vor allem deswegen, weil seit dem Zeitalter des Jukebox-Musicals ja praktisch jeder Song der Musikgeschichte Teil eines Musicals werden kann. Konzentriert man sich nun auf den Musicalaspekt in diesem Buch, zeigen sich Schwachstellen. Okay, dass Andrew Lloyd Webber im Register unter W wie Webber und nicht unter L wie Lloyd Webber eingereiht ist, kann passieren. Problematischer wird es beim Song »Don’t Cry For Me Argentina«. Da schreibt Kos: »Kennen Sie zwei Songs aus Cats? Oder zumindest einen aus Phantom der Oper [sic!]? Wer kein Musical-Fan ist, wird sich mit den Antworten schwertun. Anders als Melodien aus klassischen Musicals wie Kiss Me Cate [sic!] oder My Fair Lady haben die Songs der Ära von Andrew Lloyd Webber so gut wie nie den Weg in das breite populäre Gedächtnis gefunden. Es gab kaum Auskoppelungen, Grenzüberschreitungen in Richtung Hitparadenpop. Cats wurde zwar weltberühmt, sein bekanntester Song Memories [sic!] wurde aber kaum im Radio gespielt.«
Flapsig formuliert könnte man diese gesamte Passage als Quatsch bezeichnen. Allein von dem von Kos falsch geschriebenen Song »Memory« aus »Cats« gibt es drei Single-Veröffentlichungen: von Barry Manilow, Barbra Streisand und Elaine Paige. »The Music of the Night« kam zwei Mal in die Charts (Michael Crawford 1987, David Cook 2008). »Any Dream Will Do« aus »Joseph« war in der Version von Jason Donovan 1991 auf Platz 3 sogar der österreichischen Charts zu finden, »No Matter What« aus dem Musical »Whistle Down the Wind« darf man als globalen Hit bezeichnen, und das sind nur einige der Chartstreffer von Lloyd Webber. Kos nimmt auch ABBAs »Dancing Queen« auf, vergisst aber ABBAs Jukebox-Musical »Mamma Mia!« zu erwähnen, über dessen Wirkung bereits kulturtheoretische Werke publiziert wurden. Nichtsdestotrotz ist »99 Songs« ein sehr empfehlenswertes Buch, das, wie eben bewiesen, Ausgangspunkt vieler Diskussionen sein kann.
Wolfgang Kos: 99 Songs. Eine Geschichte des 20. Jahrhunderts. Brandstätter Verlag, Wien 2017. 320 S.; (Hardcover) ISBN 978-3710600227. EUR 39,90. brandstaetterverlag.com
Martin Bruny am Montag, den
2. April 2018 um 08:52 · gespeichert in Musical, Wien, Rezensionen, Theater, 2018
Als »Dogfight« im Juli 2012 seine Off-Broadway-Premiere feierte, waren die Songwriter Benj Pasek und Justin Paul 27 Jahre alt. 2006 hatten sie an der renommierten, 1880 gegründeten University of Michigan School of Music, Theatre and Dance ihren Abschluss gemacht, bereits 2005 ihren Songzyklus »Edges« zur Aufführung gebracht. 2009 fand die Premiere ihrer Show »A Christmas Story« statt, die es 2012 an den Broadway schaffte und 2017 als TV-Live-Spektakel von Fox produziert wurde.
»Dogfight« war ihr New-York-Debüt und in ihrem Schaffen, was die Qualität der Songs betrifft, ein Höhepunkt – stilistisch noch nicht dermaßen auf Rhythmus und Hookline fixiert wie spätere Arbeiten für Bühne, TV und Film, finessenreicher im Bau der Melodien. Nur wenige Pastiche-Stücke im Stil der 60er-Jahre definieren die Zeit, in der die Show spielt. Von Anklängen an Stephen Sondheim bis zu Jason Robert Brown schrieb die Presse. So gesehen war die Show eine Art Turning Point: Erfolg statt Raffinement war ab da (vorläufig) die Devise. »Dogfight« war in New York nach knapp einem Monat Geschichte.
Am 6. März 2018 feierte »Dogfight« Wien-Premiere. Aufgeführt von der Youth Company von Vienna’s English Theatre auf Englisch. Die Show setzt am 21. November 1963 ein, dem Tag vor dem Attentat auf John F. Kennedy, und handelt von einer Gruppe junger Marines am Abend vor ihrer Verlegung nach Vietnam. Der Höhepunkt dieser Nacht ist für sie der Dogfight, ein Wettstreit, wer von ihnen das hässlichste Mädchen zum Tanz anschleppt. Es ist eines jener Stücke, die durch die #MeToo-Debatte neue Brisanz erhalten. Birdlace, der Protagonist, reißt die junge Kellnerin Rose auf. Als die das brutale Spiel durchschaut, brüllt sie ihn an: »I hope there is a war, and you get killed. All of you, that’s what I hope.« Genau so kommt es. Wenige Szenen später sind alle Marines, bis auf Birdlace, tot, verblutet in Vietnam. Ein Rachedrama? Dazwischen liegt eine zarte Romanze zwischen Birdlace und der Kellnerin. Am Ende haben wir einen traumatisierten Mann, der sich nach wahrer Liebe sehnt.
»Dogfight« basiert auf dem gleichnamigen Film aus 1992, in dem der jung verstorbene Kultmime River Phoenix und die fabelhafte Lili Taylor spielten. Die Musicalversion bietet nicht die Möglichkeit, deren sublimes Spiel auf die Bühne zu transferieren. Der Buchautor der Show (Peter Duchan) setzt mehr auf Komik als auf Zärtlichkeit. Verdeutlicht anhand einer Szene: Als Rose und Birdlace sich für ihre gemeinsame Nacht bereitmachen, drapiert River Phoenix in der Filmversion vorsichtig, liebevoll ein Kondom unter die Kleidung eines Stoffteddys. In der Musicalversion wirft der Hauptdarsteller unbeholfen hastig das Kondom unter einen nackten Teddy. So kann man Lacher generieren, aber es verändert die Charakterzeichnung. Das Problem der Produktion der Youth Company ist, dass die ohnedies angelegte Komik noch verstärkt wird. Als die beiden im Bett liegen und das Licht abgeblendet wird, bumsen zwei Bühnenelemente, die zum Szenenwechsel eingesetzt werden, mit Absicht aufeinander. Sogar dieser intime Moment wird ins Lächerliche gezogen. Im Zentrum steht als Rose Helena Lenn, die stimmlich die Show trägt. Das Problem der Produktion ist die Regie (Adrienne Ferguson), die beim Finetuning versagt und den Moment verpasst, ab dem Rose auf der Bühne zur eindeutig dominanten Kraft wird. Da wäre mehr Fokus erforderlich gewesen. Die starken Solosongs von Rose kommen zu beiläufig, die Schlussszene ist erstaunlich wirkungsarm getimt. Daniele Spampinato ist bemüht, die Wandlung von Birdlace zu zeigen, stimmlich ist er an seinen Grenzen und bei seinem letzten Solo überfordert. Starke Momente und eine großartige Stimme hat Eduardo Medina Barcenas als Boland. Bei dieser Produktion leistet sich Vienna’s English Theatre eine Liveband. Großartig! Das Bühnenbild von Richard Panzenböck mit bewegbaren Trennelementen, die mit Stars & Stripes besprüht sind – ein Hingucker. Roberta Ajello gibt sehr bühnenwirksam die schrille Hure Marcy, die sich kaufen lässt, um mit falschen Zähnen als hässlichstes Mädchen den Dogfight zu gewinnen. Doch auch als sie Rose am Ende des ersten Akts die Regeln des Dogfight enthüllt, und in ihrem Solo »Dogfight«, ist sie durchgehend schrill. Es fehlen die Zwischentöne, andere würden sagen glaubhaftes Schauspiel – ein grundlegendes Problem dieser Produktion. Aber vergessen wir nicht, dass dies die Arbeit einer Youth Company ist, und dafür ist es erstaunlich, was dieses Theater da auf die Bühne gebracht hat.
Martin Bruny am Mittwoch, den
14. März 2018 um 02:16 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2018
Der Plan war, zuerst im Register des Buchs nachzusehen, wie oft der Name »Uwe Kröger« erwähnt wird. Marika Lichter und Uwe Kröger, das war in musicalaffinen Kreisen immerhin viele Jahre ein Faktor. Doch in der Autobiografie der Agenturchefin und Künstlerin gibt es kein Register. Der schnelle Zugriff auf die gewünschte Information war also nicht möglich. Zurück zum Anfang.
Lichters Werk, in Zusammenarbeit mit der Biografienspezialistin Silke Rabus entstanden, ist gut strukturiert. Die Themenblöcke reichen zurück bis in jene Zeit, als sich ihre Eltern kennengelernt haben, 1946, beim Fünf-Uhr-Tee im Cafà© New York in Budapest (und im Epilog bis zurück in die 1930er-Jahre). Klar in der Sprache, dicht an Informationsgehalt, angenehm und auch spannend zu lesen ist Lichters Lebensgeschichte. Lakonisch und bisweilen knochentrocken kommt die Künstlerin heute, gefiltert durch die Presse, manchmal rüber. Beim Lesen des Buches erkennt man, dass sie das von ihrer Mutter »geerbt« haben könnte. Die soll bekannt gewesen sein für markige Sprüche wie »Wer nicht älter werden will, muss sich rechtzeitig aufhängen« oder »Es gibt immer einen Grund, sich von einem Mann scheiden zu lassen.« Skurrile Sprüche findet man in Lichters Buch jede Menge, so gesehen kann man es fast als Aphorismen-Sammlung betrachten: Alice Gross-Jiresch, eine ehemals bekannte Sängerin, gab Lichter vor ihrer ersten Unterrichtsstunde am Konservatorium Wien den Rat: »Wenn du singst, darfst du niemals die Stirn runzeln. Sonst wirst du furchtbare Falten bekommen und siehst ganz hässlich aus.«
Lichter nahm an Schlagerfestivals noch vor der Matura teil, gewann Preise wie einen Filmvertrag mit Franz Antel. Aus den Filmplänen wurde freilich nichts, denn auf Lichters Frage »Herr Antel, wie wird der Film heißen?« antwortete der Regisseur: »Zieh dich aus, Liebling.« Lichter darauf: »Den Vertrag können Sie sich behalten.« Vor ihrem 18. Geburtstag textete und komponierte Lichter Schlager, interpretierte Songs etwa von Andrà© Heller und entschied, dass man mit Schlager zwar viel Geld verdienen kann (»Für einen Auftritt als Schlagersängerin bekam ich 7000 Schilling, das war Ende der 60er-Jahre ein Vermögen! Nie wieder habe ich so viel verdient wie damals.«), sie aber einen anderen Weg gehen will. Mit 18 begann sie an Oscar Bronners Cabaret Fledermaus zu singen, machte fünf Jahre sechs Tage die Woche dort Programm. Nach vielen Engagements als Operettensängerin prophezeite Lichter eine Handleserin 1977: »Sie werden eine weite Reise übers Meer machen.« Was folgte, war ihr erstes Musical-Engagement: »Mayflower« (Premiere: 2.12.1977, Theater an der Wien). Christoph Waltz, ein »Mayflower«-Kollege, wurde ein guter Freund. »Zu Weihnachten schenkte er mir ein Holzspielzeug mit einer Schnur daran. Das war ein Erfolgskletterer, und wenn ich anzog, kletterte er ein Stück nach oben.« Auch Lichters Liebes- und Familienleben kommt nicht zu kurz in diesem Buch. Sie erzählt entspannt, ohne Peinlichkeiten. Ihre gescheiterte Ehe resümiert sie so: »Als mein Sohn acht oder neun Jahre alt war, fragte er mich: Mama, was war die schwerste Entscheidung in deinem Leben? Ich antwortete, weil mir nichts Besseres einfiel: Ob ich dich zum Storch zurückschicke. Und er: War es nicht die Entscheidung, ob du den Papi rausschmeißt oder nicht? Da brach ich in Tränen aus. Warum muss ein kleines Kind so etwas wissen?« Ende der 1980er-Jahre macht Lichter Karriere als Musicalsängerin bei den VBW, gründet später ihre Agentur Glanzlichter und den Verein »Wider die Gewalt«, wird Jurymitglied bei der Castingshow »Starmania« und nimmt an »Dancing Stars« teil. Sie erzählt eine Fülle an Backstage-Storys. Lesenswert, berührend, unterhaltsam. Ach ja, Uwe Kröger kommt auch kurz vor, an vier Stellen im Buch. Keine Schmutzwäsche. Gute Entscheidung.
Marika Lichter: Mut kann man nicht kaufen. Das war’s noch lange nicht. Ueberreuter, Wien 2017. 192 S.; (Hardcover) ISBN 978-3800076840. EUR 19,95 ueberreuter-sachbuch.at
Martin Bruny am Samstag, den
10. Februar 2018 um 09:31 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Theater, Linz, 2018
Die bunte Pop-/Musical-Revue des Linzer Landestheaters, »Forever Young«, benannt nach dem Motto der Spielsaison 2017/18, ist der erwartete Crowd-Pleaser. Schon vor der Premiere: alle Vorstellungen ausverkauft. Freilich gönnt man sich eine groß konzipierte Bühne (Charles Quiggin), nur knapp 200 Zuschauer passen in den Saal. Auf der Bühne im Hintergrund eine Wand aus beweglichen Spiegelelementen, rechts die Band, ein Umkleidebereich, der bisweilen auch benützt wird. Abgangsmöglichkeiten nach allen Seiten.
Bös formuliert gliedert sich die Show in zwei Elemente: gute Performances und durch klischeehafte Musicalregie zerstörte Performances (Inszenierung, Choreografie: Simon Eichenberger; Dramaturgie: Arne Beeker). Ein Beispiel: Kristin Hölck singt »Halt mich« von Herbert Grönemeyer. Regieeinfall 1: Bei der Anmoderation muss ein Gag bezüglich Oli P. (berühmt für sein »Flugzeuge im Bauch«-Cover) und Grönemeyer (das Original) rein. Ein witziger Wortwechsel zwischen Riccardo Greco und Hölck. Regieeinfall 2: Rob Pelzer begleitet Hölck auf der Ziehharmonika. Die Idee, den Song mit Klavier und Ziehharmonika zu begleiten: toll! Regieeinfall 3: Beim emotionalen Höhepunkt werden die Spiegel im Hintergrund durchsichtig, man sieht ein Kind auf seine Eltern zulaufen. Eine Familienszene. Das ist, mit Verlaub, respektlos: dem Publikum gegenüber, es mit Kitsch zu behelligen, Hölck gegenüber, von der die volle Aufmerksamkeit, die sie mit ihrem starken Auftritt verdient, abgezogen wird. – Aber es geht auch anders. Die besten Momente in dieser Show hat Riccardo Greco. Die Erzählungen aus seiner Jugend sind liebenswert, sein »River Deep – Mountain High« ein Knaller, den Höhepunkt des Abends setzt er mit einer Interpretation von Des’rees »Kissing You«, ohne Schnickschnack (mit raffiniertem Arrangement). So nimmt man ein Lied mit all seinen Gefahren und packt ein Publikum. Peter Lewys Preston, der Mann mit der großen Popstimme, irritiert nach wie vor mit einer Gestik und Mimik, die bisweilen ihre Wucht aus der Imagination zu ziehen scheint, gerade ein Rockkonzert im Madison Square Garden zu performen. Es kommt ein entscheidendes Bisschen zu viel, auch wenn er die Song-Contest-Hymne »Gente di Mare« effektvoll interpretiert. Dann wird er noch vom Choreografen im Stich gelassen, der zwar das Problem hat, »Dancin’ Fool« aus Barry Manilows »Copacabana« auf der zwar nicht kleinen, aber für einen solchen Tanz-Act immer noch Minibühne zu inszenieren. Dennoch: etwas mehr als ein Rutsch-Fake-Step wäre schon drin gewesen. Ganz unverständlich die Jackson-5-Sequenz (»I want you back«/»ABC«). Ja, man trug damals eine andere Art von Kleidung, aber sie war im Kontext der Zeit passend geschneidert. In Linz passen den Darstellern die Kostüme »schlecht« – lautes Lachen im Publikum. (Kostüme: Richard Stockinger) Das wäre, wenn beabsichtigt, Ironie auf falscher Ebene. Auch was die Harmonie der Stimmen betrifft, eine eher unglückliche Songwahl.
Noch eine Bemerkung zu den Moderationen. Die Darsteller erzählen kleine Storys aus ihrem Leben, mit Wortwitz, sentimentalen Pointen, teilweise in ihrem Heimatdialekt. Warum hat man dieses Konzept nicht durchgezogen? Entbehrlich: typischer Musicalchoreografie-Nonsens, wenn etwa das Ensemble wie bei einer Wischbewegung am Handy, von rechts nach links oder umgekehrt über die Bühne latscht, nur damit sich etwas tut. Mehr Rock statt Musicalregie hätte bei Nirvanas »Smells like Teen Spirit« nicht geschadet. Da wird von den Darstellern während des Songs der Drummer in die Szene geschoben, sie nehmen Sticks, liefern eine mitreißende Drum-Sequenz, aber statt diese Rocknummer ausarten zu lassen und mit einem Bang zu beenden, wird der Drummer schön brav wieder mitten im Song aus der Szene geschoben. Schade. Nicht wirklich passend: die Arrangement-Attitüde bei »Think«, einer Nummer der Queen of Soul, Aretha Franklin. Statt mit albernen leuchtenden Papierhütchen zu performen, könnte man der Queen in Zeichen von #metoo etwas mehr Respect erweisen. Ihre Entertainerqualitäten beweist Ariana Schirasi-Fard mit einem sehr effektvoll arrangierten »The Rose« (Bette Midler), und mit wie viel Freude sie sich an dem Nonsens-Song »I like to move it« (Reel 2 Reel) abarbeitet – Respekt. Rob Pelzer berührt mit seinen ironisch-sarkastischen Erinnerungen an seine ersten musikalischen Begegnungen mit Bob Dylan und seiner Version von »The Times The Are a-Changin«. Fazit: Ein Abend zwischen Kitsch und packendem Entertainment.
Martin Bruny am Samstag, den
10. Februar 2018 um 02:20 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2018
Anlässlich des 100. Geburtstags von Leonard Bernstein 2018 gibt es an der Staatsoperette Dresden die volle Dosis »Wonderful Town«: eine Inszenierung, eine Cast-CD und eine Werkmonografie. In ihr reißt Wolfgang Rathert das ewig aktuelle Thema an: Was ist ein Musical? Andreas Jaensch skizziert Entstehungsgeschichte, Story, Stoff und Songs der Show. Daniel Grundlach widmet sich der Nostalgie in »Wonderful Town«, Giselher Schubert befasst sich mit dem musikalischen Stil und Andreas Eichhorn mit dem Geheimnis des Erfolgs dieser Show. Gisela Maria Schubert schließlich untersucht New York als Schauplatz von Musicals. Einen wichtigen Platz (31 Seiten) nehmen Kritik-Clippings der Broadway-Produktion (1953), aber auch jener von Dresden (2017) ein. Und Christoph Wagner-Trenkwitz steuert seinen bereits 2007 (bei Amalthea: »Es grünt so grün … Musical an der Wiener Volksoper«) veröffentlichten Artikel zur deutschsprachigen Erstaufführung in Wien bei (mit verändertem Schlusssatz). Das Problem: Es gibt keinen Textnachweis für diesen Artikel. Handelt es sich bei den anderen Artikeln also auch um Zweitverwertungen? Man weiß es nicht. Das ist das Problem, wenn man solche Angaben nicht liefert. Alle Artikel sind wissenschaftlich fundiert mit ausführlichem Anmerkungsteil. Für eine erste Einführung ist dieses Büchlein bestens geeignet.
Heiko Cullmann (Hg.); Michael Heinemann (Hg.): »… wie die Stadt schön wird.« Leonard Bernstein: Wonderful Town. Eine Werkmonografie in Texten und Dokumenten. Staatsoperette Dresden/Thelem, Dresden 2017. 164 S.; (Paperback) ISBN 978-3945363638. EUR 12,80. thelem.de
Martin Bruny am Donnerstag, den
30. November 2017 um 03:23 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2017
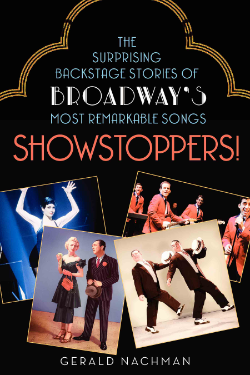 Wenn Burgtheater-Schauspielerin Maria Happel als Rose bei ihrem Volksopern-Debüt in »Gypsy« den Song »Some People« interpretiert, hat sie mit diesem eigentlichen Opener der Show Songmaterial an der Hand, das man einen programmierten Showstopper nennt. Showstopper sind jene Nummern, die Fans immer und immer wieder in dieselbe Show ziehen. Sie definieren einen Theaterabend. »A showstopper is a moment of performance so rousingly expert and energizing that the audience response – usually rapturous applause and noises that sound like bravo! – freezes the show in a moment of loud, pagan worship.« (Ben Brantley) Es gab Zeiten und Orte, unter anderem am Broadway in den 1920er- und 1930er-Jahren, da unterbrach ein Showstopper tatsächlich die Show, der Schauspieler nahm die Ovationen an, verbeugte sich. Ja, gab Zugaben. Al Jolsons Spruch »Wait a Minute, wait a minute. I tell yer, you ain’t heard nothing yet« stammt aus dieser Periode. Wird in der Volksoper wohl nicht passieren. Oder doch? Mit einem Showstopper hat man die Chance, zur Theaterlegende zu werden, da kommen Energien ins Spiel, die schwer im Vorhinein abzuschätzen sind.
Wenn Burgtheater-Schauspielerin Maria Happel als Rose bei ihrem Volksopern-Debüt in »Gypsy« den Song »Some People« interpretiert, hat sie mit diesem eigentlichen Opener der Show Songmaterial an der Hand, das man einen programmierten Showstopper nennt. Showstopper sind jene Nummern, die Fans immer und immer wieder in dieselbe Show ziehen. Sie definieren einen Theaterabend. »A showstopper is a moment of performance so rousingly expert and energizing that the audience response – usually rapturous applause and noises that sound like bravo! – freezes the show in a moment of loud, pagan worship.« (Ben Brantley) Es gab Zeiten und Orte, unter anderem am Broadway in den 1920er- und 1930er-Jahren, da unterbrach ein Showstopper tatsächlich die Show, der Schauspieler nahm die Ovationen an, verbeugte sich. Ja, gab Zugaben. Al Jolsons Spruch »Wait a Minute, wait a minute. I tell yer, you ain’t heard nothing yet« stammt aus dieser Periode. Wird in der Volksoper wohl nicht passieren. Oder doch? Mit einem Showstopper hat man die Chance, zur Theaterlegende zu werden, da kommen Energien ins Spiel, die schwer im Vorhinein abzuschätzen sind.
Warum ein Song zum Showstopper wird, wie einige legendäre Showstopper »gemacht« wurden, warum Showstopper so populär wurden, das untersucht Gerald Nachman in vorliegendem Buch und covert den Zeitraum von 1925 (»Garrick Gaieties«) bis 2005 (»Jersey Boys«).
Nachman (geboren 1938) kann als Journalist auf eine mehr als 50-jährige Karriere als Theaterkritiker und Kolumnist verweisen für Zeitschriften und Magazine wie »New York Post«, »San Francisco Chronicle«, »GQ«, »Esquire«, »Cosmopolitan« und »Theater Week«. Er ist Autor von drei Sachbüchern zur amerikanischen Populärkultur und mehreren Büchern zum Thema Humor. Außerdem schrieb er die Texte zu drei Musical-Revuen.
Für »Showstoppers!« führte er zahlreiche Interviews mit Schauspielern, Komponisten und Autoren, u. a. mit Patti LuPone, Chita Rivera, Marvin Hamlisch, Joel Grey, Edie Adams, John Kander, Jerry Herman, Sheldon Harnick, Tommy Tune, Harold Prince, Donna McKechnie und Andrea McArdle. Gegliedert hat er sein Werk in die Kapitel »Just for Openers«, »They Stopped The Show« und »O Say Can You Hear Me – Broadway Anthems«.
Nachmans Vorgehen ist ein journalistisches. Er bietet zu jedem Song interessante Anekdoten, etwa auch zum ältesten, »Manhattan«, aus der Revue »Garrick Gaieties« »which was a fundraiser meant for only a two-night run, to raise money to buy tapestries for the cash-strapped Theatre Guild at the Garrick Theatre, but the show proved so popular that it ran 211 performances and gave rise to two more editions« – sozusagen Crowdfunding in den 1920er-Jahren. Und er bietet Werturteile, die unter anderem schon durch die Auswahl der von ihm behandelten Showstopper zum Ausdruck kommen – oder durch Einleitungssätze wie folgende: »Wicked has a real story buried under all of its hokey special effects, but it’s hard to find, and almost as hard to care much about—unless you’re a fifteen-year-old girl with identity problems. (…) Like many musicals today, the show’s guiding principle behind each song seems to be, if it’s shouted loudly enough it must be a sensational showstopper.« Genüsslich zelebriert Nachman Zitate aus den Verrissen, die Stephen Schwartz am Broadway für »Wicked« einstecken musste, aber er liefert auch, und nicht nur hier, im Anhang zu den einzelnen behandelten Musical-Showstoppern ein wenig »Backstage Dish«: »As an inside musical joke, in what he calls a tribute to composer Harold Arlen, Stephen Schwartz incorporated the first seven notes of Over the Rainbow into the song Unlimited. Schwartz deftly dodged a lawsuit by the Arlen estate by not including an eighth note, which he says is where the copyright law kicks in. He disguised his good-humored theft by changing the tune’s rhythm and reharmonizing it.« Oder: »According to New York writer David Sheward and author Paul R. Laird (…) the electronics in Wicked generate enough power to supply twelve homes, using five miles of cables, and it takes 250 pounds of dry ice to create the smokey effects onstage.« Und er hat ein kleines Interview mit Stephen Schwartz geführt, in dem er ihn »über die Bande« mit seinen Kritikpunkten konfrontiert, wenn er etwa einen Freund anführt, der meint, »Wicked« sei nicht nur eine Show für junge Girls, sondern auch für Damen in seinem Alter (um die 70) und Schwartz darauf antwortet: »I love that. I think that is very accurate. I like that very much. The producers of Wicked get extremely annoyed when people say it is successful because it’s popular with teenage girls. You can’t run a show ten years in New York or all over the world if the audience consists entirely of teenage girls.«
Kein Problem hat Nachman etwa mit »La Cage aux Folles«. Für diese Show recherchierte er sehr interessante Statements, wie jenes von George Hearn, dem Albin der Musical-Uraufführung am Broadway: »It’s good it came along just before everything turned bad and we began losing people, about half the men in the cast. The zeitgeist changed and then people were at the barricades.« Nachmann zur Entstehungsgeschichte des Showstoppers »I Am What I Am«: »(Jerry) Herman recalls that the idea for the song, and the title, was born when the show’s book writer, Harvey Fierstein, arrived one day with an impassioned scene to end act 1 that included the phrase, I am what I am. Herman asked Fierstein if he could steal the phrase and promised to have a song by the next morning. He delivered it, but instead of making the lyrics overly didactic, Herman purposely created a mainstream song that just might become a hit, a song that, like the show itself, not just gays would respond to but also straight mid-American audiences.«
Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube an Geschichten, Fakten, witzigen Randbemerkungen, geschrieben von einem Musical-Liebhaber. Empfehlenswert.
Gerald Nachman: Showstoppers! The Surprising Backstage Stories of Broadway’s Most Remarkable Songs. Chicago Review Press Incorporated, Chicago 2017. 408 S.; (Broschur) ISBN 978-1-61373-102-4. $ 19,99. chicagoreviewpress.com
Martin Bruny am Sonntag, den
10. September 2017 um 02:24 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2017
Dieses kleine Büchlein ist eine wahre Fundgrube für alle, die sich für Sprache interessieren. Und Sprache, das steht schon im ersten Satz des Vorworts, ist im Showbusiness essenziell. Zitiert wird Gregory Peck, der sagte: «You struggle, you claw, and you scratch trying to camouflage a bad script. When the script is sound and the structure is there, you just sort of sail through.†Josh Chetwynd hat in seinem Buch Redewendungen, Fachbegriffe sowie legendäre Filmzitate nicht nur gelistet und erklärt, sondern er leitet sie von ihren Ursprüngen ab, geht zurück bis zur ersten schriftlichen/mündlichen Erwähnung, und das ist bisweilen richtig spannend und immer unterhaltend. Es geht um Begriffe aus dem Film, dem Theater, dem Musicalbereich. Nehmen wir als Beispiel die «Drama Queenâ€. Ursprünglich war dies als ehrenvolle Bezeichnung gedacht. Chetwynd führt neben Presseartikeln dafür auch eine Werbung aus dem Jahr 1937 für den Film ‘The Emperor’s Candlesticks’ an. Luise Rainer hatte dafür den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen und wurde in der Werbung als «Academy drama queen†gelobt. Erst in den 60ern erfuhr der Ausdruck eine Bedeutungswandlung durch die Gay Community. Und in den 70ern begann sich die negative Hauptbedeutung durchzusetzen. Als Beweis führt der Autor Pressemeldungen über die erste Drama Queen dieser Art an: Barbara Rush in der ‘New Dick Van Dyke Show’. In den 90ern schließlich gab es einen regelrechten Hype um den Ausdruck, da sich von Madonna bis Angela Bassett alle Stars als Drama Queens bezeichneten, und heutzutage spielt auch das Geschlecht keine Rolle mehr. Beleg dafür: «He’s a drama queenâ€, sagte der ehemalige Footballtrainer Jimmy Johnson 2010 über Quarterback Brett Favre. Ein blendend recherchiertes Buch, witzig, fundiert, ein Leseerlebnis.
Josh Chetwynd: Totally Scripted. Lyons Press, Guilford 2017. 224 Seiten; (Paperback). ISBN 978-1-63076-282-7. $ 14,95. rowman.com
« zurueck ·
vor »




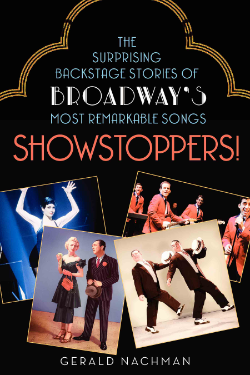 Wenn Burgtheater-Schauspielerin Maria Happel als Rose bei ihrem Volksopern-Debüt in »Gypsy« den Song »Some People« interpretiert, hat sie mit diesem eigentlichen Opener der Show Songmaterial an der Hand, das man einen programmierten Showstopper nennt. Showstopper sind jene Nummern, die Fans immer und immer wieder in dieselbe Show ziehen. Sie definieren einen Theaterabend. »A showstopper is a moment of performance so rousingly expert and energizing that the audience response – usually rapturous applause and noises that sound like bravo! – freezes the show in a moment of loud, pagan worship.« (Ben Brantley) Es gab Zeiten und Orte, unter anderem am Broadway in den 1920er- und 1930er-Jahren, da unterbrach ein Showstopper tatsächlich die Show, der Schauspieler nahm die Ovationen an, verbeugte sich. Ja, gab Zugaben. Al Jolsons Spruch »Wait a Minute, wait a minute. I tell yer, you ain’t heard nothing yet« stammt aus dieser Periode. Wird in der Volksoper wohl nicht passieren. Oder doch? Mit einem Showstopper hat man die Chance, zur Theaterlegende zu werden, da kommen Energien ins Spiel, die schwer im Vorhinein abzuschätzen sind.
Wenn Burgtheater-Schauspielerin Maria Happel als Rose bei ihrem Volksopern-Debüt in »Gypsy« den Song »Some People« interpretiert, hat sie mit diesem eigentlichen Opener der Show Songmaterial an der Hand, das man einen programmierten Showstopper nennt. Showstopper sind jene Nummern, die Fans immer und immer wieder in dieselbe Show ziehen. Sie definieren einen Theaterabend. »A showstopper is a moment of performance so rousingly expert and energizing that the audience response – usually rapturous applause and noises that sound like bravo! – freezes the show in a moment of loud, pagan worship.« (Ben Brantley) Es gab Zeiten und Orte, unter anderem am Broadway in den 1920er- und 1930er-Jahren, da unterbrach ein Showstopper tatsächlich die Show, der Schauspieler nahm die Ovationen an, verbeugte sich. Ja, gab Zugaben. Al Jolsons Spruch »Wait a Minute, wait a minute. I tell yer, you ain’t heard nothing yet« stammt aus dieser Periode. Wird in der Volksoper wohl nicht passieren. Oder doch? Mit einem Showstopper hat man die Chance, zur Theaterlegende zu werden, da kommen Energien ins Spiel, die schwer im Vorhinein abzuschätzen sind.

