Martin Bruny am Donnerstag, den
15. September 2022 um 12:49 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2022
Gleich zwei Bücher sind 2022 erschienen, die sich »Grease«, der Bühnenshow, widmen – jener Produktion, die am 7. Dezember 1979 mit der 3243. gespielten Vorstellung »Fiddler on the Roof« als »Longest-running Broadway-Show« ablöste und damit die erste »Longest-running Broadway Show« war, die keinen Tony Award gewonnen hatte. 225 Darsteller, die im Lauf der Jahre Teil der »Grease«-Familie waren, versammelten sich an jenem Abend, um das Ereignis zu feiern. Darunter John Travolta, der mit 18 als Doody bei der ersten US-Tour, danach am Broadway (und in der Verfilmung) zu sehen war, Richard Gere ebenso wie Treat Williams und Patrick Swayze. Insgesamt kam diese erste Broadway-Produktion bis zur Dernià¨re am 13. April 1980 auf 3388 Vorstellungen. Das ergibt heute in der Liste der »Longest-running Broadway Shows« noch immer den respektablen 16. Platz. Finanziell war »Grease« ein Treffer für die Investoren. Den Darstellern etwa wurde angeboten, 500 Dollar zu investieren. Denjenigen, die das Angebot annahmen, brachte das schließlich 12.000 Dollar. Bis heute erhalten die Investoren Vergütungen zweimal pro Jahr. Das Revival von 1994 erreichte 1505 Vorstellungen und liegt damit in jener Liste auf Platz 65, das Revival von 2007 brachte es auf 554 Vorstellungen. Bis heute gingen weltweit mehr als 120.000 Produktionen von »Grease« über die Bühne.
Scott Miller: Go Greased Lightning!
Scott Miller, Harvard-Absolvent (Musik und Musiktheater), hat zwölf Musicals geschrieben, zwei Sprechstücke und mehr als ein Dutzend Sachbücher zum Thema Musiktheater. 1991 gründete er in St. Louis das New Line Theatre, dessen künstlerischer Leiter er bis heute ist, und er schreibt einen Blog mit dem Titel »The Bad Boy of Musical Theatre«
Miller ist »Grease«-Fanboy und holt in seinem Buch die Show, die heute oft durch die Verfilmung gefiltert produziert und rezipiert wird, in die Gegenwart. Miller: »Many people underestimate the intelligence, authenticity of Grease and its score, they completely misunderstand what happens at the end of Grease. Admittedly, that’s partly because the movie dialed back the edgier aspects of the story, and inserted a new finale that made the ending less clear. But the film didn’t change the ending. For the record, Sandy does not become a slut to win Danny. The exact opposite is true. She rejects the cultural oppression of the 1950s and her parents, and for the first time, claims her own body, curves, and sexuality. Though it might not be obvious, Sandy is the protagonist, and the story ends not with her submission, but with her newfound freedom and self-possession, with strength. The second reason for this book is that Grease is about the Others, those that don’t conform to mainstream ideas of how we’re supposed to live, act, look. America has always been great at shitting on the Others, Native Americans, African slaves, immigrants, women and black voters, queer people. But here, early in the twenty-first century, America is changing – drastically and fast – and that change is terrifying to some people. As in our past, those who are fearful today are in search of Others to blame. As I write this in mid-2022, America has lost its collective mind, much as we did in the 1960s. And it makes Grease unusually relevant all over again.« Auf 142 Seiten bietet Miller eine Analyse, wie sich das »adult concept musical«, in dem es mehr um eine Idee denn um eine Geschichte geht, zu einer romantischen Musicalkomödie gewandelt hat, in der die Darsteller clean wie Kandidaten bei Castingshows auftreten. »That robs the show of its substantial authenticity. It turns the kids into cardboard cutouts, instead of poor, ignored, working class kids just trying to get laid. Grease is not a show about how crazy those wacky kids in the 50s were, and by the way, isn’t young love cute? No, Grease is a social document.« Sehr empfehlenswert.
Scott Miller: Go Greased Lightning! The Amazing Authenticity of »Grease«. Independently published by Scott Miller 2022 (via Amazon). ISBN: 979-8-84-708619-6. $ 19,95
Tom Moore, Adrienne Barbeau, Ken Waissman (Hgg.): Grease
Dieses Buch ist eine herausgeberische Meisterleistung. Die Idee dazu ist entstanden, als sich die Alumni der ersten US-»Grease«-Produktion (inkl. der US-Tourproduktionen bis 1980) mitten in der Pandemie via Zoom kurzschlossen und besprachen, wie man das 2022 anstehende 50-jährige Jubiläum der Broadway-Premiere feiern könnte. Angelegt ist das Werk als ein verschriftlichtes Gespräch. Beteiligt sind daran mehr als 100 Darsteller, Musiker, Mitglieder des Kreativteams, die in Statements von ihren »Grease«-Erfahrungen berichten. Sie haben den drei Herausgebern Tom Moore (Regisseur der Show), Adrienne Barbeau (Rizzo-Darstellerin) und Ken Waissman (Produzent) ihre schriftlichen Beiträge geschickt, und deren Aufgabe war es, daraus ein funktionierendes Ganzes zu formen. Es gibt viele Bücher über das Musicalgenre, über Epochen, aber nur wenige, die den Lauf einer Produktion komplett abdecken, von der Idee über Castingprozesse, die verschiedenen Versionen der Show vor der Premiere bis zur Premiere, von den CD-Aufnahmen, den Tour-Casts bis zur Dernià¨re. Genau das ist hier auf unterhaltsame, spannende Weise gelungen. Mit einer Vielzahl an Details, zum Beispiel, was die Tony Awards 1972 betrifft. Ken Waissman: »Although geographically located off-Broadway, we were in a 1.,100-seat house, paying Broadway Equity scale to the actors and Broadway scale to the musicians. Our press agent, Betty Lee Hunt, and I decided that Grease should be considered Broadway and eligible for the Tony Award. I spoke to Alexander Cohen, who produced the annual Tony Awards show on behalf of the League of New York Theaters and Producers, the American Theatre Wing, and the ABC network. I was told that in order to qualify, a show must be in a official Broadway house located within the square blocks bound by Forty-First Street and Fifty-Fifth Street, from Ninth Avenue to Sixth Avenue. We decided to file a lawsuit against the League, the Wing, and ABC.« Etwas abgekürzt: Waissman konnte sich durchsetzen, die Show bekam sieben Nominierungen, aber: »The majority of the Tony voters didn’t respond to their invitations to come downtown to see the show, so we knew we wouldnt win any Tonys. However, we were able to publicize the nominations, and Grease was mentioned six times in the national broadcast. With the Tony broadcast, Grease achieved full acceptance as an authentic Broadway musical. We had arrived. This paved the way for our transfer to a theater smack in the middle of the Broadway theater district.« In jedem Beitrag dieses Buchs spürt man den Enthusiasmus und die Leidenschaft für das Musicalgenre. Sehr empfehlenswert.
Tom Moore, Adrienne Barbeau, Ken Waissman (Hgg.): Grease. Tell me more, tell me more. Stories from the Broadway Phenomenon That Started It All. Chicago Review Press, Chicago 2022. ISBN‎ 978-1-64-160758-2. $ 30,00 chicagoreviewpress.com
Martin Bruny am Freitag, den
15. Juli 2022 um 12:52 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2022
Robert W. Schneider und Shannon Agnew (Hg.): Fifty Key Stage Musicals
In diesem Jahr feiert das unverwüstliche Musical »Grease« sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Die Broadway-Produktion, die vom 14. Februar 1972 bis zum 13. April 1980 in vier verschiedenen Theatern zu sehen war, ist es jedoch nicht, die es als eine von 50 Shows in das von Robert W. Schneider und Shannon Agnew herausgegebene Buch »Fifty Key Stage Musicals« geschafft hat, sondern das »Grease«-Revival, das vom 11. Mai 1994 bis 25. Januar 1998 im Eugene O’Neill Theatre gegeben wurde. Die Gründe, warum es diese Produktion sein musste, heißen unter anderem: Linda Blair, Debby Boone, Sheena Easton, Deborah Gibson, Jasmine Guy und Jody Watley. Sie alle (und einige mehr) standen in der Hitshow als Betty Rizzo auf der Bühne. Sie waren ausschlaggebend dafür, warum das Revival, das nach einer Anfangseuphorie bald schon schwächelte, Jahre am Spielplan blieb. Als Fran und Bran Weissler, die Produzenten des Revivals, feststellten, dass der Ticketvorverkauf rapide abnahm, entwickelten sie nämlich eine Methode, um neue Publikumsschichten ins Theater zu holen. Heute ist das, was damals entworfen wurde, eine gängige Masche: Stunt Casting (im Gegensatz zu Star Casting und Star Replacement Casting). Statt Triple Threats zu casten, suchte man gezielt Celebritys. Im Extremfall mussten sie nicht mal Theatererfahrung haben, sondern einfach die besondere Gabe, Leute ins Theater zu locken. »Grease« war dafür unter anderem deswegen eine ideale Show, weil es Rollen darin gibt, die nicht viel an Allroundfähigkeiten verlangen. Miss Lynch muss nicht singen können, Teen Angel hat nur einen Starauftritt … Mark Madama, der Autor des Essays über »Grease«, formuliert die Regeln des Stunt Castings wie folgt: »Rule one, look for a celebrity who is either currently trending in the news/pop culture, or visit a time machine to rediscover a star who’s still able to ignite warm nostalgic memories. Rule two, hire, sometimes without auditioning, said celebrity and plug them into the role most, or even somewhat, suited for them in your Broadway show. Rule three, devise a marketing campaign to exploit this celebrity’s current or past notoriety. Rule four, hope that your celebrity has the theatre technique to sustain their performance in a grueling eight-show-a-week Broadway schedule. Usually, Broadway contracts can be anywhere from six months to two years, but the stars cast as stunt casting can be as little as a few weeks.« Jazz-Legende Al Jarreau als Teen Angel, Chartsstürmer Jon Secada als Danny Zuko, Brooke Shields als Betty Rizo, sie alle waren Kassenmagneten. Shields brachte zusätzliche 40.000 Dollar pro Woche, Al Jarreau zusätzliche 100.000 Dollar. Zeitweise bestand das Publikum zu 25 bis 30 Prozent aus Besuchern, die noch nie vorher eine Broadway-Show besucht hatten.
Dass diese Show als eines von 50 Key Stage Musicals klassifiziert wurde, sorgt anfangs vielleicht etwas für Erstaunen, die Wahl ist jedoch dem Konzept geschuldet, das die Herausgeber ihrem Werk zugrunde gelegt haben. Sie definierten 50 Musicals, die für die Weiterentwicklung des Genres bestimmend waren, es handelt sich also nicht um eine Auswahl der »besten« Shows. 50 Autoren befassen sich in Essay-Form vor allem mit jeweils einem entscheidenden Faktor, der das von ihnen gewählte Werk essenziell werden ließ für den Erfolg zumindest eines weiteren. 1996 etwa brachten Fran und Bran Weissler ihr nächstes Projekt an den Start: das Revival von »Chicago«. Und ihr Erfolgszezept ging auch hier auf. Die Produktion ist nach wie vor zu sehen (derzeit unten anderem mit Pamela Anderson) und trägt das Label: »Longest running show to have premiered on Broadway«. Am 26. Juni 2022 ging Vorstellung Nummer 10.002 über die Bühne. Ganz offiziell liegt vor »Chicago« als »longest running show on Broadway« nur eine Produktion: »The Phantom of the Opera« (13.645 Vorstellungen).
Die Liste der prominenten Musicals, die bei einem solchen Konzept auf der Strecke blieben, ist lang. »The Music Man«, »The Book of Mormon«, sämtliche Film- und TV-Musicals, Kultmusicals wie »Bare« oder »Spiderman: Turn Off The Dark«, alles von Jason Robert Brown etc. Den Grund formulieren die Herausgeber folgendermaßen: »… we could not find a large enough impact of their works on the creation of other works no matter how much joy they gave audiences throughout their runs or how much they brought musicals into the popular discourse.«
Das Buchprojekt hat auch einen Ableger im Internet, siehe https://tinyurl.com/KeyMusicals. Alle Episoden sind gratis und frei zugänglich, man muss dafür nicht das Buch gekauft haben. Die 50 Musicals des Buches werden hier noch ausführlicher und in Gesprächen zum Beispiel mit den Komponisten oder aber mit den Autoren der jeweiligen Kapitel analysiert.
Dem Konzept des Dominoeffekts entsprechend ist das erste Musical, das besprochen wird, »The Black Crook« (1866) und das letzte »Dear Evan Hansen« (2016). Ganz abgesehen davon, ob man sich mit diesem Konzept anfreunden kann, ist die gewählte Beobachtungsperspektive der 50 Autoren immer eine interessante, und es ist durchaus spannend, wie sie die für sie entscheidenden Aspekte herausarbeiten. Am Beispiel »La Cage Aux Folles«: »When La Cage Aux Folles first opened on Broadway, audiences uproariously laughed when a son looked at a man and called him Mother. In the two subsequent Broadway revivals of this show in 2005 and 2010, when that line was said there was less and less laughter from the audience. Of course, it is natural for a child to have two parents of the same gender, the audience thinks.« Am Beispiel von »Dear Evan Hansen«: The Producers have realized the power that social media holds in ensuring their show’s success. The widespread nature of social media places the power of critique in the fandom’s hands and out of the critics. Everyone is entitled to an opinion, and everyone is granted a space online to share it. A strong online following guarantees that a show, at the very least, will not disappear. Dear Evan Hansen is the proof. The producers of Dear Evan Hansen struck a home run when they tapped into the world of social media, building a show about the internet that could be financed by the internet. Shows like The Lightning Thief (2014) and Be More Chill (2015) are prime success stories of this model; both shows received Broadway runs thanks to large social media followings that kept them alive well after it was assumed their potential had been squashed.« 324 Seiten Lesevergnügen.
Robert W. Schneider und Shannon Agnew (Hg.): Fifty Key Stage Musicals. Routledge, New York 2022. ISBN 978-0-36-744441-9. $ 166,73. https://www.routledge.com
Martin Bruny am Mittwoch, den
15. Juni 2022 um 12:53 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2022
Vor 15 Jahren, zu Beginn der Direktionszeit von Robert Meyer an der Volksoper Wien, hat Christoph Wagner-Trenkwitz (CWT, so das für ihn gängige Kürzel) das Buch »â€šEs grünt so grün …‘ Musical an der Wiener Volksoper« veröffentlicht. Im Vorwort schrieb Meyer: »Musical gehört in dieses Haus. Wir wissen, dass dieses Genre von der Volksoper aus seinen kontinentaleuropäischen Siegeszug angetreten hat. Jedem Volksopern-Direktor muss es daher ein Anliegen sein, Musical hier zu pflegen.« Leicht überspitzt formuliert könnte man dieser Tage meinen: Mag sein, aber vielleicht nicht jeder Volksopern-Direktorin …
In ihrer ersten Saisonpräsentation am 20. April 2022 war die Wortspende der neuen Direktorin Lotte de Beer zum Thema Musical im Bereich der Wiederaufnahmen angesiedelt. Wortwörtlich sagte sie: »Und ‚Anatevka‘, wobei wir Dominique Horwitz gefunden haben, um Tevje zu spielen.« Das war’s, kein weiteres Wort zum Thema Musical.
Objektiv gesehen kann man noch nicht sagen, welchen Stellenwert Musical an der Volksoper unter de Beer haben wird. Objektiv gesehen muss man aber auch sagen, dass es in der ersten Spielzeit von Robert Meyer (der Publikumsliebling bleibt der Volksoper als Ensemblemitglied in diversen Übernahmen weiterhin treu; CWT verlässt das Haus und bindet sich als Dramaturg stärker ans Gärtnerplatztheater) ebenfalls keine Musical-Neuproduktion gab. Die Schlussworte von CWT in seinem neuen Buch »Willkommen, bienvenue, welcome! Musical an der Volksoper Wien«, das in Kooperation von Amalthea Verlag und Volksoper entstanden ist, lauten: »Ein Schlusswort? Das erscheint nicht nötig, denn das Thema ‚Musical an der Volksoper‘ ist keineswegs abgeschlossen und wird es wohl auch nie sein. Aber, so viel steht bereits fest, das Musical wird zunächst keine so prominente Rolle mehr spielen wie in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten. Für die erste Saison unter der Direktion von Lotte de Beer ist keine Premiere in diesem Genre angekündigt, doch kann sie, was Repertoirestücke und potenzielle Wiederaufnahmen betrifft […], aus dem Vollen schöpfen. Künstlerische, aber auch kommerzielle Überlegungen werden wohl dafür sorgen, dass das Publikum der Volksoper wieder bei einer Musical-Neuproduktion willkommen geheißen wird!«
Kann man daraus tatsächlich ableiten, dass ein Schatten über der näheren Zukunft des Musicals an der Volksoper liegt? Ich glaube, es verhält sich ein wenig wie mit Schroedingers Katze. Liest man die von CWT verfasste Passage, vielleicht. Da aber Michael Bertha, ein Pressesprecher der Volksoper, in einer Aussendung Anfang Mai formulierte »Musical in Wien ist ohne die Volksoper nicht vorstellbar. Und umgekehrt ist dieses Haus ohne Musical nicht vorstellbar«, warten vielleicht einige Überraschungen.
Musicalgeschichte wird zuerst gemacht – auf der Bühne – und danach geschrieben, meist von Kritikern und im Anschluss daran von Autoren, die zu Themen, Genres oder einer bestimmten Epoche Analysen verfassen. Aus der Sicht eines Theaters/einer Intendanz ist es klug, ein eigenes Reading der konzipierten und verwirklichten Ära schriftlich festzuhalten. Schon wenige Jahre nach ihrem Abtreten ist nicht mehr gar so viel problemlos zu recherchieren, was denn tatsächlich stattgefunden hat, wie Produktionen entstanden sind. Immer weniger an Hintergrundgeschichten bleibt in erzählbarer Erinnerung, es mag auch das Interesse daran schwinden. Ein Buch ist eine gute Möglichkeit, Anekdoten auszugraben, interessante Hintergrundgeschichten zu formulieren, eine Ära also im Rückblick gut auszuleuchten. CWT macht das in seinem Buch ausführlich. Ein Mal noch zieht er erzählerisch den Bogen ganz zurück bis in die Ära von Marcel Prawy, rafft die Musicalgeschichte der Volksoper Wien von 1952 bis 2007 auf 128 Seiten zusammen, um sich danach auf rund 120 Seiten der Ära Meyer zu widmen. Die Bausteine seiner Erzählung sind Gespräche mit Mitwirkenden, Anekdoten, in denen er Begegnungen mit Protagonisten der Musicalgeschichte wie Stephen Sondheim schildert, aber auch Blicke hinter die Kulissen auf Castingprozesse, dramaturgische Entscheidungen. Und ironisch formulierte Abrechnungen mit Kritikern, wenn sie nicht mit der nötigen Genauigkeit gearbeitet haben. Eine Premierenkritik zu »Hello, Dolly!« (2010) etwa kommentiert CWT wie folgt: »Die einzige abfällige Kritik stammte aus der Feder des Musical-Skeptikers Heinz Sichrovsky (‚News‘), die sich selbst allerdings schon mit der Einleitung richtete: ‚Unter den spärlichen [!] Meisterwerken des Genres hatte Jerry Hermans Musical ‚Hello, Dolly!‘ nie Platz [!]. Die klassische Verfilmung und das Titellied camouflierten die musikalische und literarische Substanzarmut der kuriosen Nestroy-Adaption John Steinbecks.‘ Wohl wurden im Programmheft einige Zitate Steinbecks abgedruckt, doch fußt das Musical auf einer Komödie von Thornton Wilder, wie bereits auf der ersten Seite des betreffenden Heftes nicht verschwiegen wurde …«
Zahlen und Daten kommen in dem Buch nicht zu kurz. Prägnant lässt sich damit die Bedeutung des Musicalgenres in der Ära Meyer illustrieren: In der Spielzeit 2009/2010 wurde an 27 Abenden Musical gegeben. In der letzten Saison (2021/2022) werden es 70 gewesen sein. In der Ära Prawy (1956–1972) gab es 7 Musicalpremieren, von 1972 bis 2007, dem Beginn der Direktion Meyers brachten 6 Direktoren ebenfalls 7 Musicalpremieren auf die Bühne. In Meyers Amtszeit, die 15 Jahre umfasst, waren es 23 Premieren, davon 15 Volksopern-Erstaufführungen. Das Resümee der Wiener Volksoper von 1952 bis 2022: 1 Europäische Erstaufführung (»Wonderful Town«), 8 Österreichische Erstaufführungen (»Porgy and Bess«, »Kiss me, Kate«, »Show Boat«, »South Pacific«, »Brigadoon« sowie die deutschsprachigen Erstaufführungen »Annie Get Your Gun« »West Side Story« und »Karussell«), 3 Wiener Erstaufführungen (»La Cage aux Folles«, »Der Zauberer von Oz«, »Gypsy«) und 1 Uraufführung (»Vivaldi«).
Für den Anhang des Buches hat Rainer Schubert, der Vizedirektor der Volksoper, für alle Produktionen seit 1952 die Vorstellungszahlen inkl. Premiere und Voraufführungen exkl. öffentliche Gastproben zusammengestellt. Mit Stand 9. April 2022 kommt er auf 2299 Aufführungen von 29 verschiedenen Werken in 44 Inszenierungen. Die vollständige Besetzung (inkl. der Zahl der Vorstellungen die jede Darstellerin bzw. jeder Darsteller gespielt hat) kann via QR-Code abgerufen werden und ist Teil der E-Book-Ausgabe. Im Buch aufgelistet sind alle Inszenierungen mit den Premierendaten, Angaben zum Dirigenten, zur Inszenierung, Bühnenbild, Kostüme … Eine gelungene letzte Zugabe der Ära Meyer.
Christoph Wagner-Trenkwitz: Willkommen, bienvenue, welcome! Musical an der Volksoper Wien. Amalthea, Wien 2022. ISBN 978-3-99050-224-2. € 30,–. www.amalthea.at
Martin Bruny am Montag, den
23. Mai 2022 um 07:55 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2022
 »Hör mal, Heinz, ich bin gerade mit Falco auf Tour und habe den Artikel gelesen, den du in der Männer Vogue über ihn veröffentlicht hast. Großartiger Text. Allein schon, was du über den Kommissar geschrieben hast – eine mürbe, ironische Koks-Feier, ein Rap mit einem böhmisch-jiddischen Zungenschlag, hahaha! Und du hast natürlich völlig recht, Falco ist im Moment der einzige Künstler, den wir hierzulande haben, der Bowie das Wasser reichen kann. Genau so will ich das! So einen Tonfall brauche ich von dir.« Mit diesen Worten startete der deutsche Konzertveranstalter Marek Lieberberg 1987 in ein Gespräch mit dem deutschen Rocksänger, Liedermacher und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze. Worum es in dem Telefonat ging? Kunze: »Ich hatte keinen Schimmer, wovon er sprach. Marek fuhr fort: Sagt dir das Musical Les Misà©rables etwas? Ich habe die Rechte für die deutschsprachige Erstaufführung gekauft. Das Ganze wird in Wien stattfinden, im Raimund Theater. Ich mache das zusammen mit Peter Weck. Und du wirst den Text übersetzen! […] Auf zwar wenigen, aber faszinierenden Seiten skizziert Kunze (in Zusammenarbeit mit Oliver Kobold) seine zweite Karriere als Übersetzer. »Marek, es freut mich wahnsinnig, dass du an mich gedacht hast. Aber wieso denkst du denn, dass ich dafür der Richtige sein könnte? Ich habe in meinem Leben nur Lola von den Kinks übersetzt, mehr nicht. Und mit Musicals kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe nicht mal ein einziges auch nur gesehen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass du das kannst. Höchste Zeit, dass mal ein frischer Wind reinkommt bei den deutschen Musical-Texten. Und du bist der richtige Mann dafür. Ich will einen anderen Zungenschlag, einen anderen Tonfall. Genauer, poetischer, musikalischer. Ich gebe dir drei Monate Probezeit, dann sehen wir weiter.« In den darauffolgenden Passagen schildert Kunze seine Arbeit am Text und in Wien vor Ort in der letzten heißen Phase vor der Premiere der Show 1988: »Der erste große Dialog zwischen Valjean, dem ehemaligen Häftling, und Javert, dem Polizisten, schnürte mir die Kehle zu. Enthüllt wird die Ähnlichkeit der beiden Männer, denn Javert ist selbst im Gefängnis aufgewachsen, als Sohn eines Wärters. Das ist der Grund für die Unerbittlichkeit, mit der er Verbrecher jagt – sie halten die Erinnerung an seine Kindheit wach, die er so gerne hinter sich lassen würde. Im Original lautete sein Geständnis: You know nothing of Javert / I was born inside a jail / I was born with scum like you / I am from the gutter, too! Besonders die Zeile I was born inside a jail kostete mich Nerven. Ich fand und fand keine Entsprechung, die mir gefiel. Erst als ich den Teil fürs Ganze nahm, wurde es Poesie und war nicht mehr nur Dienstleistung: Ich liebe die Zeilen bis heute. Was weißt du schon von Javert? / Gitter brach mein Wiegenlicht / Dreck sah meiner Mutter zu / Ich stamm aus dem Dreck wie du. Während der Proben in Wien holten sie bei solchen Passagen kurz Luft und steckten die Köpfe zusammen: Hos d’ dös g’hert, wos der do gschrieb’n hot?« »Miss Saigon«, Andrew Lloyd Webbers »Joseph« und »Rent« sind Kunzes weitere Karrierestationen als Übersetzer. Mit viel Witz und auch gnadenloser Offenheit skizziert er seine Sicht auf die Musicalbranche. Am Beispiel »Rent«: »An der Qualität des Musicals bestand keine Zweifel. Aber ob das deutsche Publikum wirklich zu einer Konfrontation mit dem richtigen Leben bereit war, noch dazu ohne entlastenden Orchesterschmelz, sondern mit der Wucht einer richtigen Rockband […]« Wir wissen, wie es ausging. »Rent« lief in Düsseldorf 1999 keine drei Monate, in Berlin nur wenig länger. Kunze: »Das deutsche Publikum fand keinen Zugang zu dem Stück und blieb beim Bewährten. Bei Zuckerguss und Utopie.« Aber nicht nur die Musicalpassagen entwickeln einen beeindruckenden Sog. Kunzes Autobiografie ist voller Anekdoten mit deutschen, österreichischen und internationalen Stars. Spannend, oft berührend, eine großartige Biografie, immer im Bestreben, den richtigen Tonfall zu treffen: »Peter Weck kam vorbei […] und wollte sich persönlich vom Fortgang der Proben überzeugen: »Na, Kinder, wos hobt’s Schöns ’mocht? Darf i amoi schaun? Charme, den man nicht lernen, nur haben kann. Das Wien von Sissi und Hans Moser; das Wien, das an der schönen blauen Donau liegt und wo im Prater wieder die Bäume blühen – wenn Peter Weck den Raum betrat, existierte es noch immer. Er setzte sich zwischen Gale Edwards und mich und ließ sich einige Szenen zeigen, erst nach einer Weile traute ich mich, den Kopf zu drehen. Weck liefen die Tränen übers Gesicht. Er weinte vor Glück. Und ich war plötzlich zehn Zentimeter gewachsen.«
»Hör mal, Heinz, ich bin gerade mit Falco auf Tour und habe den Artikel gelesen, den du in der Männer Vogue über ihn veröffentlicht hast. Großartiger Text. Allein schon, was du über den Kommissar geschrieben hast – eine mürbe, ironische Koks-Feier, ein Rap mit einem böhmisch-jiddischen Zungenschlag, hahaha! Und du hast natürlich völlig recht, Falco ist im Moment der einzige Künstler, den wir hierzulande haben, der Bowie das Wasser reichen kann. Genau so will ich das! So einen Tonfall brauche ich von dir.« Mit diesen Worten startete der deutsche Konzertveranstalter Marek Lieberberg 1987 in ein Gespräch mit dem deutschen Rocksänger, Liedermacher und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze. Worum es in dem Telefonat ging? Kunze: »Ich hatte keinen Schimmer, wovon er sprach. Marek fuhr fort: Sagt dir das Musical Les Misà©rables etwas? Ich habe die Rechte für die deutschsprachige Erstaufführung gekauft. Das Ganze wird in Wien stattfinden, im Raimund Theater. Ich mache das zusammen mit Peter Weck. Und du wirst den Text übersetzen! […] Auf zwar wenigen, aber faszinierenden Seiten skizziert Kunze (in Zusammenarbeit mit Oliver Kobold) seine zweite Karriere als Übersetzer. »Marek, es freut mich wahnsinnig, dass du an mich gedacht hast. Aber wieso denkst du denn, dass ich dafür der Richtige sein könnte? Ich habe in meinem Leben nur Lola von den Kinks übersetzt, mehr nicht. Und mit Musicals kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe nicht mal ein einziges auch nur gesehen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass du das kannst. Höchste Zeit, dass mal ein frischer Wind reinkommt bei den deutschen Musical-Texten. Und du bist der richtige Mann dafür. Ich will einen anderen Zungenschlag, einen anderen Tonfall. Genauer, poetischer, musikalischer. Ich gebe dir drei Monate Probezeit, dann sehen wir weiter.« In den darauffolgenden Passagen schildert Kunze seine Arbeit am Text und in Wien vor Ort in der letzten heißen Phase vor der Premiere der Show 1988: »Der erste große Dialog zwischen Valjean, dem ehemaligen Häftling, und Javert, dem Polizisten, schnürte mir die Kehle zu. Enthüllt wird die Ähnlichkeit der beiden Männer, denn Javert ist selbst im Gefängnis aufgewachsen, als Sohn eines Wärters. Das ist der Grund für die Unerbittlichkeit, mit der er Verbrecher jagt – sie halten die Erinnerung an seine Kindheit wach, die er so gerne hinter sich lassen würde. Im Original lautete sein Geständnis: You know nothing of Javert / I was born inside a jail / I was born with scum like you / I am from the gutter, too! Besonders die Zeile I was born inside a jail kostete mich Nerven. Ich fand und fand keine Entsprechung, die mir gefiel. Erst als ich den Teil fürs Ganze nahm, wurde es Poesie und war nicht mehr nur Dienstleistung: Ich liebe die Zeilen bis heute. Was weißt du schon von Javert? / Gitter brach mein Wiegenlicht / Dreck sah meiner Mutter zu / Ich stamm aus dem Dreck wie du. Während der Proben in Wien holten sie bei solchen Passagen kurz Luft und steckten die Köpfe zusammen: Hos d’ dös g’hert, wos der do gschrieb’n hot?« »Miss Saigon«, Andrew Lloyd Webbers »Joseph« und »Rent« sind Kunzes weitere Karrierestationen als Übersetzer. Mit viel Witz und auch gnadenloser Offenheit skizziert er seine Sicht auf die Musicalbranche. Am Beispiel »Rent«: »An der Qualität des Musicals bestand keine Zweifel. Aber ob das deutsche Publikum wirklich zu einer Konfrontation mit dem richtigen Leben bereit war, noch dazu ohne entlastenden Orchesterschmelz, sondern mit der Wucht einer richtigen Rockband […]« Wir wissen, wie es ausging. »Rent« lief in Düsseldorf 1999 keine drei Monate, in Berlin nur wenig länger. Kunze: »Das deutsche Publikum fand keinen Zugang zu dem Stück und blieb beim Bewährten. Bei Zuckerguss und Utopie.« Aber nicht nur die Musicalpassagen entwickeln einen beeindruckenden Sog. Kunzes Autobiografie ist voller Anekdoten mit deutschen, österreichischen und internationalen Stars. Spannend, oft berührend, eine großartige Biografie, immer im Bestreben, den richtigen Tonfall zu treffen: »Peter Weck kam vorbei […] und wollte sich persönlich vom Fortgang der Proben überzeugen: »Na, Kinder, wos hobt’s Schöns ’mocht? Darf i amoi schaun? Charme, den man nicht lernen, nur haben kann. Das Wien von Sissi und Hans Moser; das Wien, das an der schönen blauen Donau liegt und wo im Prater wieder die Bäume blühen – wenn Peter Weck den Raum betrat, existierte es noch immer. Er setzte sich zwischen Gale Edwards und mich und ließ sich einige Szenen zeigen, erst nach einer Weile traute ich mich, den Kopf zu drehen. Weck liefen die Tränen übers Gesicht. Er weinte vor Glück. Und ich war plötzlich zehn Zentimeter gewachsen.«
Heinz Rudolf Kunze: Werdegang. Reclam, Ditzingen 2021. ISBN 978-3-15-011379-0. $ 19,90 €. www.reclam.de
Martin Bruny am Freitag, den
8. April 2022 um 20:02 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2022
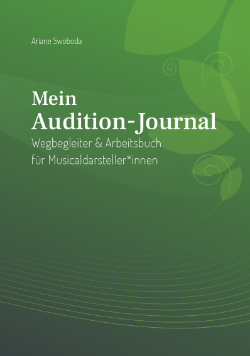 Die Situation kennt jeder. Man steht vor einer Herausforderung und sucht … Orientierung, Tipps, Hilfe, möglichst in einer Form, die eine Instant-Erleichterung verschafft, etwa indem grundlegende Fragen leicht erfassbar erklärt werden, Aspekte, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als wichtig erkannt hat, thematisiert werden. Profis mit möglichst reicher Erfahrung sind in all diesen Fällen die Ansprechpartner der Wahl.
Die Situation kennt jeder. Man steht vor einer Herausforderung und sucht … Orientierung, Tipps, Hilfe, möglichst in einer Form, die eine Instant-Erleichterung verschafft, etwa indem grundlegende Fragen leicht erfassbar erklärt werden, Aspekte, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als wichtig erkannt hat, thematisiert werden. Profis mit möglichst reicher Erfahrung sind in all diesen Fällen die Ansprechpartner der Wahl.
Ariane Swoboda arbeitet seit vielen Jahren in der Musicalbranche. Sie hat am Konservatorium der Stadt Wien sowie am Tanz-Gesang-Studio im Theater an der Wien, das Peter Weck 1984 gegründet hat (und das Mitte der 1990er-Jahre geschlossen wurde), studiert und ist seit ihrem Abschluss Anfang der 1990er-Jahre in zahlreichen Rollen, etwa bei den Wiener Produktionen von »Grease«, »Die Schöne und das Biest«, »Elisabeth«, »Tanz der Vampire«, »The Producers« »Evita«, und vielen anderen zu sehen gewesen, 2021 als Olivia in »I Feel Love«, einer Produktion der Vereinigten Bühnen Bozen. An der Wiener Broadway Academy gibt sie Audition Classes und unterrichtet Liedinterpretation.
Ihr Ratgeber startet mit Tipps für die Zeit des Studiums. Methodisch geschickt werden Anleitungen in leicht zu merkenden Schritt-für Schritt-Programmen formuliert, organisatorische Rahmenbedingungen wie Jahrgangsprüfungen besprochen, ebenso Bewerbungstools oder der Umgang mit Social Media. Man findet Listen von Agenturen, nützliche Hinweise für den Bereich Finanzen (steuerliche Absetzbarkeit von Fotos; Audition-Bestätigungen/Reisekosten für die Steuererklärung) und einen Test, der einem dabei hilft, zu erkennen, welcher Audition-Typ man ist. Infos zu E-Casting und About-me-Videos gibt es ebenso. Im Tonfall wertschätzend, Wissen und Erfahrung vermittelnd, reicht das Buch von sehr konkreten Tipps, etwa was man zu Fotoshootings alles mitnehmen muss, bis zu Praxisübungen, zum Beispiel, welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann, Theater aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen: »Ich möchte, dass Sie ins Theater gehen! Sie werden sagen: Das mache ich sowieso – Ich liebe Musicals. Aber ich möchte, dass Sie sich diesmal nicht verzaubern lassen. Dieses Mal möchte ich, dass Sie sich Notizen machen. […] Seien Sie analytisch – am besten gehen Sie alleine. Kaufen Sie sich ein Ticket weiter hinten – damit Sie die ganze Bühne übersehen. […]« Punkt für Punkt wird skizziert, welche Aspekte der Show analysiert werden sollten. Die Vorgehensweise entspricht in etwa jener, die Theaterkritiker anwenden, wenn auch mit einem anderen Resultat. Dem Dechiffrieren von Auditionausschreibungen folgt im Hauptteil eine ausführliche Anleitung, wie man in fünf Schritten zu einer organisierten Präsentation kommt und einen Auditiontag zu einem Erfolg für sich gestaltet, egal ob ein konkretes Jobangebot am Ende steht oder nicht.
Ariane Swoboda hat nicht nur einen Ratgeber und ein Arbeitsbuch (mit Arbeitsblättern) verfasst, sondern auch ein Motivationsbuch. Praxistipps von u. a. Simon Eichenberger (Regisseur, Choreograf, Agent), Stefan Huber (Regisseur), Carsten Paap (Dirigent), Koen Schoots (Dirigent, Arrangeur), Andreas Gergen (Regisseur), Sascha Oliver Bauer (Regisseur), Josef E. Köpplinger (Staatsintendant), Matthias Davids (Regisseur und künstlerische Leitung Landestheater Linz), Bettina Bogdany (Musicalsängerin, Pianistin, Musikkabarettistin, Songschreiberin und musikalische Leiterin), Jerà´me Knols (Choreograf und Dance Captain), Alex Balga (Intendant der Sommerfestspiele Amstetten und Regisseur), Caspar Richter (Musikdirektor), Christopher Tölle (Regisseur, Choreograf), Bela Fischer Jr. (Musiker), Ricarda Regina Ludigkeit (Regie, Choreografie, Tanzpädagogik) und Christian Struppeck (Musicalintendant VBW) zeigen, was bei Auditions von Praktikern konkret erwartet wird.
Zurück zu den am Beginn angesprochenen Aspekten, die manche eventuell gar nicht im Fokus haben. Koen Schoots: »Jede*r musikalische*r Leiter*in, jede*r Dirigent*in wird sich freuen, wenn im Lebenslauf bei der Auflistung der Produktionen nicht nur der*die jeweilige Regisseur*in und Choreograph*in genannt werden, sondern auch der Musikdirektor. Jedenfalls hat der*die Bewerber*in dann bei mir schon ein paar Pluspunkte gutgeschrieben, denn das zeugt von Respekt für unseren Beruf, der mit den Jahren leider immer weniger respektiert wird.«
Ariane Swoboda: Mein Audition-Journal. Wegbegleiter & Arbeitsbuch für Musicaldarsteller*innen. myMorawa, Dataform Media GmbH, Wien 2021. ISBN 978-3-99125-717-2. $ 19,90 €. www.morawa.at
Martin Bruny am Dienstag, den
8. Februar 2022 um 20:00 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2022
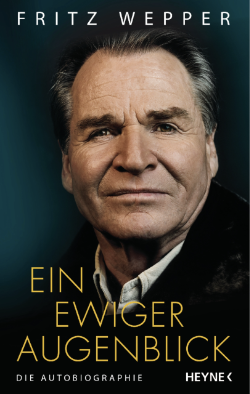 Im Mai 1973 eröffnete sich dem deutschen Schauspieler Fritz Wepper die Chance seines Lebens. Im Zuge eines Promotion-Trips nach New York für das Filmmusical »Cabaret« hatte der 31-Jährige ein Meeting mit der Music Corporation of America (MCA), der damals einflussreichsten Schauspieleragentur Hollywoods, bei der Größen wie Kirk Douglas, Fred Astaire, James Stewart und Bette Davis unter Vertrag standen. Die Vertreter kamen mit konkreten Angeboten: ein Theaterstück am Broadway, danach ein Film in Kanada und ein weiterer in Los Angeles. Auf die Frage nach seinen terminlichen Verpflichtungen antwortete Wepper bei diesem Treffen: »I’m busy this year and I have an option for next year.« Ein fataler Fehler. »Forget it, Fritz. Good luck«, war die Antwort der Vertreter der Agentur. Der Grund für die Abfuhr: Der Begriff »Option« bedeutet im Deutschen für einen Schauspieler ein Rollenangebot, das er auch ablehnen kann. Im amerikanischen Fachjargon besagt eine solche Aussage allerdings, dass man vertraglich gebunden ist. Die MCA ging davon aus, dass Wepper nicht vor 1975 verfügbar sei, und hatte ihr Interesse an ihm verloren.
Im Mai 1973 eröffnete sich dem deutschen Schauspieler Fritz Wepper die Chance seines Lebens. Im Zuge eines Promotion-Trips nach New York für das Filmmusical »Cabaret« hatte der 31-Jährige ein Meeting mit der Music Corporation of America (MCA), der damals einflussreichsten Schauspieleragentur Hollywoods, bei der Größen wie Kirk Douglas, Fred Astaire, James Stewart und Bette Davis unter Vertrag standen. Die Vertreter kamen mit konkreten Angeboten: ein Theaterstück am Broadway, danach ein Film in Kanada und ein weiterer in Los Angeles. Auf die Frage nach seinen terminlichen Verpflichtungen antwortete Wepper bei diesem Treffen: »I’m busy this year and I have an option for next year.« Ein fataler Fehler. »Forget it, Fritz. Good luck«, war die Antwort der Vertreter der Agentur. Der Grund für die Abfuhr: Der Begriff »Option« bedeutet im Deutschen für einen Schauspieler ein Rollenangebot, das er auch ablehnen kann. Im amerikanischen Fachjargon besagt eine solche Aussage allerdings, dass man vertraglich gebunden ist. Die MCA ging davon aus, dass Wepper nicht vor 1975 verfügbar sei, und hatte ihr Interesse an ihm verloren.
Fritz Wepper widmet »Cabaret« demgemäß in seiner Autobiografie zwar ein Kapitel, aber ein mit 18 Seiten recht schmales. Doch erstens sind O-Töne, so kurz sie auch sein mögen, stets Gold wert, und immerhin bietet der Schauspieler kurze Einblicke in die Zeit der Auditions und Dreharbeiten für »Cabaret«: »In der Bavaria kannte ich fast alle Bühnenbildner und Beleuchter, schließlich hatte ich dort schon mit zwölf meinen ersten Film gedreht. Einen fragte ich: Wie läuft’s denn so? Und er antwortete: Du, der Fosse sagt mir bei jedem Nagel genau, wie ich den in die Deko haun’n soll. Der hat ’ne klare Vision. […] Bob Fosse rauchte ziemlich viel. Mit Fluppe im Mund gab er ständig Anweisungen. Wenn einer von uns vieren [Liza Minnelli, Michael York, Marisa Berenson und Fritz Wepper] in Großaufnahme zu sehen war, stellte er die anderen neben die Kamera und forderte sie auf, möglichst intensiv zu spielen. So wollte er dafür sorgen, dass alle ihr Bestes gaben, Wer gerade im Bild war, wurde also nicht zum pausierenden Stichwortgeber, sondern forderte seine Kollegen richtiggehend heraus, das sieht man auch am Ergebnis. So was hatte ich vorher noch nie erlebt. Das war handwerkliches Neuland für mich.« Innerhalb dieses Abschnitts konzentriert sich die weitere Erzählung dann auf die Freundschaft mit Liza Minnelli und Treffen mit Showgrößen der damaligen Zeit. Wepper abschließend zu diesem Kapitel in seiner Karriere: »Hollywood habe ich im Nachhinein nie ernsthaft vermisst, denn es öffneten sich für mich stattdessen viele andere Türen.«
Fritz Wepper: Ein ewiger Augenblick. Die Autobiographie. Heyne, München 2021. ISBN 978-3-453-21819-2. $ 20,– €. www.heyne.de
Martin Bruny am Mittwoch, den
8. Dezember 2021 um 20:03 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2021
 Sieht man sich auf amazon.com die Bewertungen der Käufer des hier besprochenen Buches an, fällt der relativ hohe Prozentsatz an Ein-Stern-Urteilen auf. Mehr als 30 Prozent entschieden sich dafür, dem Buch die schlechteste aller möglichen Noten zu geben. Der Großteil davon gibt als Grund nicht etwa den Text an, sondern bemängelt die Herstellung des Buchs an sich. Der Buchblock habe sich vom Einband gelöst, der Buchkern sei aufgebrochen. Warum der Verlag eher eine günstigere Herstellungsweise einkalkuliert haben könnte, ist aber vielleicht ironischerweise an genau diesen Bewertungen abzulesen. Auf amazon.com haben das im April 2021 erschienene Buch 18 Käufer, auf amazon.de um sechs weniger bewertet. Wünschen darf man sich viel, auch teuer produzierte Bücher, aber Verlage müssen die finanziellen Möglichkeiten vor dem Hintergrund einer absetzbaren Auflage im Auge behalten. Früher oder später werden Fachbücher wie diese vielleicht nur mehr digital angeboten. Der Preis wird dann nicht wesentlich tiefer liegen.
Sieht man sich auf amazon.com die Bewertungen der Käufer des hier besprochenen Buches an, fällt der relativ hohe Prozentsatz an Ein-Stern-Urteilen auf. Mehr als 30 Prozent entschieden sich dafür, dem Buch die schlechteste aller möglichen Noten zu geben. Der Großteil davon gibt als Grund nicht etwa den Text an, sondern bemängelt die Herstellung des Buchs an sich. Der Buchblock habe sich vom Einband gelöst, der Buchkern sei aufgebrochen. Warum der Verlag eher eine günstigere Herstellungsweise einkalkuliert haben könnte, ist aber vielleicht ironischerweise an genau diesen Bewertungen abzulesen. Auf amazon.com haben das im April 2021 erschienene Buch 18 Käufer, auf amazon.de um sechs weniger bewertet. Wünschen darf man sich viel, auch teuer produzierte Bücher, aber Verlage müssen die finanziellen Möglichkeiten vor dem Hintergrund einer absetzbaren Auflage im Auge behalten. Früher oder später werden Fachbücher wie diese vielleicht nur mehr digital angeboten. Der Preis wird dann nicht wesentlich tiefer liegen.
Doch wie kam es zur Entstehung des vorliegenden Werks? Im Jahr 2018 entwickelte man im Verlagshaus Rowman & Littlefield den Plan, die bestehende Enzyklopädie-Reihe mit einer Ausgabe über Stephen Sondheim zu erweitern, und auf der Suche nach einem Autor kam man auf den Theaterkritiker und Musikjournalisten Rick Pender. Er hat von 2004 bis 2016 mehr als 40 Ausgaben des Magazins »The Sondheim Review« als Herausgeber und Chefredakteur betreut und nach dessen Einstellung (ohne Erfolg) versucht, mit »Everything Sondheim« ein Online-Nachfolgemodell zu etablieren. Pender glaubte anfangs, man wolle ihn als Herausgeber verpflichten und ihm die Aufgabe übertragen, die Beiträge aller engagierter Autoren zu einer Einheit zu formen, doch der Verlag machte ihm rasch klar, dass man aufgrund des begrenzten Budgets nur einen Autor verpflichten wolle, nämlich ihn. In seinem Autorenvertrag fand sich unter dem Punkt »geplanter Umfang« folgende Angabe: 300.000 Wörter. Das gedruckte Buch umfasst 638 Seiten, Pender arbeitete daran zwei Jahre.
Nicht unwesentlich bei diesem Projekt ist die Frage, ob Sondheim selbst involviert war. Hier meinte Pender in einem Radiointerview, er habe sich an die drei Mantras Sondheims gehalten (die er auch im Buch beschreibt): 1. »Content Dictates Form.« 2. »Less Is More« und Punkt 3: »God Is in the Details.« Letzterem folgend habe er den Komponisten gebeten, den ausführlichen biografischen Beitrag zu lesen und zu korrigieren. Für weitere Detailfragen stand Sondheim dem Autor per Mail zur Verfügung und antwortete meist innerhalb von 24 Stunden.
Das Nachschlagewerk ist alphabetisch in 133 Einträge gegliedert. Pender hatte ursprünglich mehr als 200 Einzelbeiträge in seinem Konzept vorgesehen, aber, um wieder auf die einleitenden Sätze Bezug zu nehmen: Der Verlag ersuchte um Reduktion (in dem Fall wohl eher nicht auf Sondheims Mantra »Less Is More« anspielend).
Natürlich findet man in Penders Buch ausführliche Darstellungen aller 18 großen Sondheim-Musicals (aber eben nicht einiger kleinerer Werke), man findet Biografien der wichtigsten Darsteller, Regisseure, Designer und weiterer wesentlichen Personen in der künstlerischen Umsetzung von Sondheims Werk (zum Beispiel auch ein Kapitel über Barbra Streisand). Es werden essenzielle Lieder aus den Werken näher beleuchtet, wie etwa »Children Will Listen«, »Not a Day Goes By« oder »Sooner or Later«. Als Hauptquellen benützte Pender die rund 80 Ausgaben der »Sondheim Review« sowie jene Bücher, die bisher über Sondheim erschienen sind, sowie Radio- und Zeitungsinterviews. Für die Songanalysen erarbeitete er Zusammenfassungen der von Mark Eden Horowitz für »The Sondheim Revue« verfassten Reihe »Biography of a Song«. Am Ende jedes Eintrags liefert der Autor stets eine Liste seiner Quellen.
Was der Verlag sich wünschte, war ein Standardwerk. Hauptzielgruppe von Rowman & Littlefield sind bei dieser Enzyklopädie Universitäten und Bibliotheken – ebenfalls ein Grund für die Preisgestaltung. Penders Aufgabe war es also, ein fundiertes und auf seine Richtigkeit überprüftes Werk zu schaffen, das man als erste Anlaufquelle in Sachen Sondheim verwenden kann, und gleichzeitig eine Fülle an weiterführenden Tipps anzubieten. Das ist rundum gelungen.
Neben den Haupteinträgen erarbeitete Pender eine Reihe von, wie er es in einem Interview bezeichnet hat, »Sidebars«. Zum Beispiel eine Liste von Lieblingsfilmen des Komponisten (kompiliert aus Gesprächen mit Sondheim und diversen anderen Quellen). Nicht fehlen darf eine halbe Seite zu den Lieblingsbleistiften Sondheims (Blackwing, und zwar das Modell »slate-gray 602«): »Blackwings are special pencils that Sondheim preferred because of their very soft lead, which makes them not only easy to write with (although extremely smudgy) but also encourages the user to waste time repeatedly sharpening them, since they wear out in minutes.« Auf knapp sechs spannenden Seiten beleuchtet Pender im Spiegel einer Fülle von Zitaten Sondheims ambivalentes Verhältnis zur Oper. Sondheim: »Opera isn’t primarily about storytelling, therefore I get impatient, although part of me knows I shoudn’t.«
Weitere »Sidebars«: »Contributions to Works by Others, »International Productions«, »Juvenile Works«, »Libraries and Archives«, »Lyric Studies«, »Movie Musicals« oder auch »Musical Likes (and Dislikes). In einem eigenen Kapitel wird Sondheims Liebe zu »Puzzles, Games, and Mysteries« untersucht, Weggelegtes in »Unproduced and Abandoned Projects« behandelt. Ein eigenes Kapitel widmet Pender der TV-Serie »Topper«: Nach dem College versuchte sich der junge Sondheim in Hollywood als Drehbuchschreiber. Im Sommer 1953 machte Oscar Hammerstein II ihn auf einer Dinnerparty mit George Oppenheimer bekannt. Der bekannte Drehbuchautor hatte gerade den Auftrag für eine Pilotfolge der Serie »Topper« erhalten und suchte einen »assistant writer«. Für 300 Dollar die Woche arbeitete Sondheim gemeinsam mit Oppenheimer an einigen Folgen der Serie. Auch das eine von vielen spannenden Geschichten, die Pender für seine sehr empfehlenswerte Enzyklopädie eigens recherchiert hat.
Rick Pender: The Stephen Sondheim Encyclopedia. Rowman & Littlefield, Lanham 2021. ISBN 978-1-5381-1586-2. $ 135,00. www.rowman.com
Martin Bruny am Samstag, den
2. Oktober 2021 um 14:26 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Bücher, 2021
 Vorliegendes Buch ist eine Zusammenstellung von Beiträgen, die für ein Symposion erarbeitet wurden, das 2017 in Freiburg stattfand. Etwas allgemeiner formuliert war der Anlass für den Band der Umstand, dass die Geschichte der Kunstform Musical (und der Operette) in manchen Ländern aufgrund bestimmter Hemmnisse nicht geschrieben wird beziehungsweise über die Landesgrenzen hinaus nicht bekannt ist.
Vorliegendes Buch ist eine Zusammenstellung von Beiträgen, die für ein Symposion erarbeitet wurden, das 2017 in Freiburg stattfand. Etwas allgemeiner formuliert war der Anlass für den Band der Umstand, dass die Geschichte der Kunstform Musical (und der Operette) in manchen Ländern aufgrund bestimmter Hemmnisse nicht geschrieben wird beziehungsweise über die Landesgrenzen hinaus nicht bekannt ist.
Ein paar Bemerkungen zu dieser grundlegenden Problematik am Beispiel Österreich: Die Anzahl der Werke, die sich kritisch mit Musicals in Österreich auseinandersetzen, ist gering. Berücksichtigte man jene Bände nicht, die in Zusammenarbeit mit Theatern (oft in gewisser (finanzieller) Abhängigkeit) erscheinen, es bliebe praktisch nichts übrig. Die letzten beiden Jahrzehnte sind unbeleuchtet. Die Gründe? Zum Beispiel der Markt. Musicalinteressierte kaufen keine Bücher, sagen die Verlage. Nicht mal Biografien von Musicalstars schaffen respektable Auflagezahlen. Neuerscheinungen werden daher immer rarer. Bleibt die akademische Aufarbeitung, doch auch da ist das Interesse überschaubar. Symptomatisch der Titel einer aktuellen Diplomarbeit zum Thema: »Wien 1970–2000: eine Musicalmetropole?« (Jasmin Kofler, 2020). Die letzten beiden Jahrzehnte werden gar nicht berücksichtigt, der Rest infrage gestellt. Als Einleitungszitat steht eine Sentenz aus »Schikaneder« – einer Show, die nicht in den Untersuchungszeitraum fällt. Was fehlt, sind Erzählerpersönlichkeiten. Marcel Prawy war ein Botschafter der Oper, Operette und des Musicals. In seiner Nachfolge hat Christoph Wagner Trenkwitz eine Aufarbeitung der Geschichte des Musicals an der Volksoper in Angriff genommen. Sein Buch »Musical an der Wiener Volksoper« behandelt die Geschichte des Hauses bis 2007. Die Geschichte des Musicals am Theater an der Wien wurde von Peter Back-Vega, Dramaturg der Vereinigten Bühnen Wien, bis zum Jahr 2008 in einem Band bearbeitet. – Einzelpersönlichkeiten, die sich in den letzten Jahren, was Bücher betrifft, nicht mehr der Musicalgeschichte gewidmet haben. Wen wundert es also, dass wir von der Musicalgeschichte anderer Länder, etwa den osteuropäischen, noch weit weniger wissen als von unserer eigenen.
Die Situation im Deutschland ist etwas anders, hier gibt es eine Erzählerpersönlichkeit: Wolfgang Jansen. 2008 veröffentlichte er mit »Cats & Co« seine »Geschichte des Musicals im deutschsprachigen Raum«, bei Recherchen für einen geplanten Nachfolgeband zur Geschichte des Musicals in der DDR stellte sich ihm eine grundlegende Frage: Ist es überhaupt sinnvoll, die Geschichte des Musicals in der DDR abgelöst vom politischen, gesellschaftlichen System, in dem es sich entwickelte, zu schreiben? Hat das DDR-Musical eine singuläre Stellung oder ist es nur im Rahmen der allgemeinen Entwicklung des Genres im kommunistischen Osteuropa nach 1945 zu verstehen? Aufgrund der Sprachbarrieren war es Jansen nicht möglich, in einem zufriedenstellenden Ausmaß an Datenmaterial zu bekommen. So entstand die Idee zu einem Symposion mit dem Thema: »The development of operettas and musicals after 1945 unter the social and ideological conditions of socialism in the East European countries.« Die Hauptfragestellungen: »Did the uniform (prescribed) worldview lead to identical plays, or are there – in spite of transnational ideology – national specific differences? Were there specific aesthetic phases of national development? What influence did the import of works from abroad, from the fraternal socialist countries, or the capitalistic West have on the national production? Were there any governmental guidelines for authors and composers? When and under what conditions changed the repertoire to the musical? Which social, cultural and political value was measured by the state to the popular musical theatre? Who were the most important authors and composers? Was there a socialist operetta, a socialist musical, and what political, social and ideological issues were negotiated in the form of popular musical theater on stage.«
Beiträge von 14 Forscherinnen und Forscher aus der Sowjetunion, Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei, Rumänien und Deutschland (für die ehemalige DDR) sind im vorliegenden englischsprachigen Band publiziert. Schwerpunktmäßig konzentriert sich das Buch auf Ungarn (83 Seiten) und die DDR (65 Seiten). Der Theaterhistoriker Gyöngyi Heltai etwa berichtet über die Rolle, welche ab den 1960ern dem Budapester Operettentheater im Rahmen der ungarischen Außenpolitik und Kulturdiplomatie zugewiesen wurde – bis in jüngste Gegenwart. Als etwa am 31. Mai 2011 die ungarische EU-Präsidentschaft mit einer offiziellen Schlussveranstaltung ausklang, ging im Bukarester Operettentheater eine zweisprachige Aufführung von Gà©rard Presguvics »Romeo & Julia« über die Bühne. Romeo sang auf Rumänisch, Julia auf Ungarisch. Diplomaten aus 40 Ländern besuchten die Produktion des Budapester Operettentheaters, die die negativen Auswirkungen von ethischen Konflikten zeigen sollte. Derartige Events des Operettentheaters fanden auch in Italien und England statt.
Pavel Bà¡r berichtet von der ersten Musical-Premiere in der Tschechoslowakei: »Finian’s Rainbow« (in einer bearbeiteten Version mit dem neuen Titel »Der wuntertätige Topf«), Anfang März 1948, nur wenige Tage nach dem kommunistischen Putsch vom Februar 1948. Es war gleichzeitig die letzte Produktion eines amerikanischen Musicals bis 1963: »Kiss Me, Kate«. Allerdings kamen ab Ende der 1950er-Jahre Werke aus der DDR und Italien zur Aufführung. Zu einem völligen Neubeginn, so Bà¡r, kam es nach der »Samtenen Revolution« vom November 1989: »… the centrally planned economy was transformed into a capitalist system, and the transformation was naturally also reflected in the theatre culture: free private theatre business could return to the theatre system after more than 40 years. The previously unchanging theatre network, which was controlled by the state, started to change. In the summer of 1992, Adam Nà³vak, the first Czechoslovak musical producer, staged the famous Les Misà©rables. Thanks to the co-production with Cameron Mackintosh, this first production introduced Czechoslovak theatre to new qualities and foreign experience […]« Dieses Buch versammelt spannende Analysen, Geschichten, Daten und Fakten. Allein der Anmerkungsapparat vieler Artikel ist ein wertvoller Fundus. Unter musicallexikon.eu finden sich online (»Musicals nach Ländern geordnet«) ergänzende Angaben zum Kapitel DDR. Lesenswert.
Wolfgang Jansen: Popular Music Theatre under Socialism. Operettas and Musicals in the Eastern European States 1945 to 1990. Waxmann, Münster 2020. ISBN 978-3-8309-4248-1. € 34,90. waxmann.com
Martin Bruny am Mittwoch, den
28. Juli 2021 um 12:27 · gespeichert in Musical, Rezensionen, Tonträger
Die Corona-Pandemie hat ganz unterschiedlich bei uns allen zugeschlagen, was Zeit und Kommunikation betrifft. Die einen hatten auf einmal viel Zeit zur Verfügung und versuchten sich in den diversen Pandemieablenkungen wie Brotbacken. Die anderen waren im Dauerstress. Etwa weil Abgabefristen noch volatiler wurden als sonst, sich laufend verschoben, plötzlich akut wurden. Die Kommunikation verlagerte sich bei vielen ins Digitale, und bei manchen scheint diese Volatilität wohl dazu geführt zu haben, ganz auf Kommunikation zu verzichten. So habe ich zum Beispiel erst Monate nach Erscheinen der DVD »Frank Wildhorn & Friends: Live From Vienna« erfahren, dass ich den Begleittext zu dieser DVD verfasst habe. Eine etwas kafkaeske Situation.
Ursprünglich hatte ich den Text vor elf Jahren für meine Website verfasst. Am 7. Oktober 2010 fragten die Produzenten der Show per Mail:
Lieber Martin Bruny,
ich bin die Künstlerische Produktionsleitung des Konzerts “Frank Wildhorn & friends” vom vergangen Montag in Wien.
Ich würde gerne aus Ihrem Artikel im Kultur-chanell.at den Teil, der sich direkt auf das Konzert bezieht, ins englische übersetzen und Frank Wildhorn resp. der amerikanischen PR zur Verfügung stellen.
Ebenso mit den Bildern unter Angabe des Fotografen.
Ich bitte um kurze Bestätigung und Angabe des zu nennenden Copyright-verweises.
Herzlichen Dank und liebe Grüße,
Renate Gritschke
Diese Verwendung war aus meiner Sicht kein Problem. Wo beziehungsweise ob dieser Text dann tatsächlich eingesetzt wurde, habe ich nicht weiter verfolgt. Als Monate später eine CD der Show veröffentlicht wurde, kontaktierte mich die ausführende Plattenfirma und fragte, ob es okay sei, den Text zu verwerten. Das war es.
Zehn Jahre später denselben Text ohne Nachfrage für eine DVD zu verwenden, ist aus meiner Sicht allerdings nicht mehr okay. Der Text war im Eindruck einer Liveshow entstanden, schon die Verwendung für eine CD-Veröffentlichung ist da nur gerade noch vertretbar. Dann aber nach zehn Jahren einen Text zu verwenden, der mit keiner Silbe auf die Bildebene eingeht, ist nicht mehr in Ordnung. Vor allem nicht ohne Kontaktaufnahme.
Ich würde ja eventuell nun noch ein paar Zeilen über die DVD schreiben, aber auch Belegexemplar ist keines angekommen.
Martin Bruny am Montag, den
24. Mai 2021 um 08:27 · gespeichert in Rezensionen, Bücher, 2021
 Lange hat sich Eddie Shapiro Zeit gelassen für den Nachfolgeband der 2014 erschienenen Interviewsammlung »Nothing Like A Dame – Conversations with the Great Women of Musical Theater«. Scherzhaft erzählt er in Interviews gerne, dass die Arbeit an diesen beiden Büchern so lange gedauert habe, weil es so schwierig gewesen sei, Termine mit den Darstellern zu vereinbaren. Und dann so zeitaufwendig, die jeweils mehrere Sessions umfassenden und bis zu 14 Stunden dauernden Gespräche, die bei den Künstlern zu Hause stattfanden, zu verarbeiten. Die Arbeit an »A Wonderful Guy – Conversations with the Great Men of Musical Theater« begann Shapiro 2016, seit ein paar Wochen ist der Band am Markt, und als Leser hat man diesmal mit der Zusammenstellung der Interviewpartner ein noch größeres Problem als schon 2014 bei den Damen. Natürlich ist die Riege der 19 Männer, die hier in Interviewform porträtiert werden, herausragend: Joel Grey (89), John Cullum (91), Len Cariou (81), Ben Vereen (74), Michael Rupert (69), Terrence Mann (69), Howard McGillin (67), Brian Stokes Mitchell (63), Marc Kudisch (54), Michael Cerveris (60), Norm Lewis (57), Will Chase (50), Christopher Sieber (52), Norbert Leo Butz (54), Christian Borle (47), Raàºl Esparza (50), Gavin Creel (45), Cheyenne Jackson (45) und Jonathan Groff (36). Wer könnte sich da beschweren? Nichtsdestotrotz beträgt, um es ein wenig plump auf eine Zahl runterzubrechen, ihr Durchschnittsalter 61 Jahre. Der Autor spricht dies im Vorwort auch direkt an: »The primary prerequisite was that all the men in this book have a robust and ongoing career in musicals. Theater had to be the thing for which they are best known. There are fantastic performers who have done extraordinary work in musicals, but Broadway isn’t their primary residence (Hugh Jackman, Alan Cumming, Neil Patrick Harris). There are other greats who contributed more significantly as creators than performers (Tommy Tune, Lin-Manuel Miranda, Harvey Fierstein). And there are excellent working actors who may not yet have had the opportunity to shine as leading men, or to do quite as many shows (I love you, Ben Platt, but the list of shows we’d be able to discuss is a short one – at least as of this writing).« Ja, so kann man das sehen. Einen Mangel an Fragen, die man Ben Platt stellen könnte, würde man aber dann doch eher dem Autor anlasten wollen Und sind Jonathan Groff und Cheyenne Jackson tatsächlich noch vor allem aufgrund ihrer Karriere am Theater bekannt? Natürlich muss man berücksichtigen, dass eine Reihe an Broadwaystars kein Interesse hatte, interviewt zu werden (etwa Nathan Lane). Wie auch immer: Um auch einen Blick auf die ganz junge Generation zu bieten, hätte es nicht geschadet, etwa Wesley Taylor, Jeremy Jordan oder Jay Armstrong Johnson ins Gespräch zu holen.
Lange hat sich Eddie Shapiro Zeit gelassen für den Nachfolgeband der 2014 erschienenen Interviewsammlung »Nothing Like A Dame – Conversations with the Great Women of Musical Theater«. Scherzhaft erzählt er in Interviews gerne, dass die Arbeit an diesen beiden Büchern so lange gedauert habe, weil es so schwierig gewesen sei, Termine mit den Darstellern zu vereinbaren. Und dann so zeitaufwendig, die jeweils mehrere Sessions umfassenden und bis zu 14 Stunden dauernden Gespräche, die bei den Künstlern zu Hause stattfanden, zu verarbeiten. Die Arbeit an »A Wonderful Guy – Conversations with the Great Men of Musical Theater« begann Shapiro 2016, seit ein paar Wochen ist der Band am Markt, und als Leser hat man diesmal mit der Zusammenstellung der Interviewpartner ein noch größeres Problem als schon 2014 bei den Damen. Natürlich ist die Riege der 19 Männer, die hier in Interviewform porträtiert werden, herausragend: Joel Grey (89), John Cullum (91), Len Cariou (81), Ben Vereen (74), Michael Rupert (69), Terrence Mann (69), Howard McGillin (67), Brian Stokes Mitchell (63), Marc Kudisch (54), Michael Cerveris (60), Norm Lewis (57), Will Chase (50), Christopher Sieber (52), Norbert Leo Butz (54), Christian Borle (47), Raàºl Esparza (50), Gavin Creel (45), Cheyenne Jackson (45) und Jonathan Groff (36). Wer könnte sich da beschweren? Nichtsdestotrotz beträgt, um es ein wenig plump auf eine Zahl runterzubrechen, ihr Durchschnittsalter 61 Jahre. Der Autor spricht dies im Vorwort auch direkt an: »The primary prerequisite was that all the men in this book have a robust and ongoing career in musicals. Theater had to be the thing for which they are best known. There are fantastic performers who have done extraordinary work in musicals, but Broadway isn’t their primary residence (Hugh Jackman, Alan Cumming, Neil Patrick Harris). There are other greats who contributed more significantly as creators than performers (Tommy Tune, Lin-Manuel Miranda, Harvey Fierstein). And there are excellent working actors who may not yet have had the opportunity to shine as leading men, or to do quite as many shows (I love you, Ben Platt, but the list of shows we’d be able to discuss is a short one – at least as of this writing).« Ja, so kann man das sehen. Einen Mangel an Fragen, die man Ben Platt stellen könnte, würde man aber dann doch eher dem Autor anlasten wollen Und sind Jonathan Groff und Cheyenne Jackson tatsächlich noch vor allem aufgrund ihrer Karriere am Theater bekannt? Natürlich muss man berücksichtigen, dass eine Reihe an Broadwaystars kein Interesse hatte, interviewt zu werden (etwa Nathan Lane). Wie auch immer: Um auch einen Blick auf die ganz junge Generation zu bieten, hätte es nicht geschadet, etwa Wesley Taylor, Jeremy Jordan oder Jay Armstrong Johnson ins Gespräch zu holen.
Doch bleiben wir bei Jonathan Groff. Hat man das Interview mit ihm gelesen, ist es klar, warum er von Shapiro gewählt wurde und warum er am Cover abgebildet ist. Er mag zwar TV-Hitshows haben und ja, eine Rolle im programmierten Blockbuster »Matrix 4« (läuft ab Dezember 2021 in den Kinos), doch: »… his heart, says Groff, belongs to the theater. Even when I was doing the TV show, Boss, in Chicago, he tells me excitedly, I hired Sutton Foster’s understudy to teach me the tap dance from Anything Goes, which he performed at a benefit. In my world, in my mind, and in my heart, I am always thinking about theater.«
Sehr anschaulich beschreibt Shapiro in seinen Intro-Texten zu den Interviews die jeweiligen Settings, in denen die Gespräche stattgefunden haben (und wann sie geführt wurden), er bietet einen kurzen Überblick über das Schaffen seiner Gesprächspartner und ist dann bemüht, Highlights, aber auch persönliche Krisen anhand ihrer Arbeit herauszuarbeiten, indem er kurze Fragen stellt und hofft, dass die Leute etwas zu sagen haben und ins Reden kommen. Perfekt vorbereitet ging der Autor in seine Gespräche, eine bemerkenswerte Empathie ist aus seinen Fragestellungen abzulesen.
»A Wonderful Guy« ist voller wundervoller Geschichten. Etwa wenn Raàºl Esparza über seine Arbeit mit Stephen Sondheim an einem Song (aus »Sunday in the Park with George«) erzählt: »He was so specific with his notes and nothing seemed to be right. But I began to realize that everything he was working on with us was like opening a series of doors into the play. One idea after another after another was being released by tiny things, like, When these two notes happen in the orchestra, you’re changing brushes. It’s a new color. When this diminuendo occurs between them, it’s their whole relationship in one breath. They begin to sing loudly to each other and then they fade away. It’s not finished yet. The second time you say the word look it means something different and beautiful because you’re talking about change, and you’re talking about the passage of time.«
Offenheit zeichnet die Gespräche durch die Bank aus. Existenzielle Probleme werden schonungslos thematisiert. Etwa von Norbert Leo Butz, der 2001 zwei Broadway-Shows nacheinander hatte, die nach wenigen Wochen schließen mussten (»Thou Shalt Not« und »The Last Five Years«), der sich noch dazu zu jener Zeit in Scheidung befand und doch nur zögernd, nachdem er eine Audition abgelehnt hatte, eine Rolle in »Wicked« übernahm. Schon allein worauf er sein Engagement zurückführt, ist kurios: »And frankly, I think I got it because Kristin is so tiny and I’m only five seven. It would be hard to cast somebody who’s six foot two next to Kristin. So I did it.« Seine nüchterne Einschätzung dieser Erfahrung: »Personally, obviously, I was going through hell. But in the process I was really unhappy. They had such a difficult time trying to figure out what the play was and what it was about. The supporting roles got lost in the shuffle. I remember feeling hamstrung and like it wasn’t good enough material to work on. I was wanting more and I was wanting to make more of an impression on the play and to make it deeper. One of the producers joked to me, Who cares? It’s all about the girls, but I realized he was right. And the creative team had some differences of opinion about the way that it should go. So as an actor, it wasn’t completely fulfilling. But I was so grateful to have a paycheck. It just saved my butt. I kept thinking I was going to be fired any week. People were getting fired left and right from [the tryout in] San Francisco. I was so grateful when they kept me for New York.«
Shapiro ist schon an Band 3 der Buchserie dran. Geplanter Titel: »It Takes A Woman«. Darauf kann man sich freuen.
Eddie Shapiro: A Wonderful Guy. Conversations with the Great Men of Musical Theater. Oxford University Press, New York 2021. ISBN 978-01-909298-9-3. $ 39,95. global.oup.com
« zurueck ·
vor »




 »Hör mal, Heinz, ich bin gerade mit Falco auf Tour und habe den Artikel gelesen, den du in der Männer Vogue über ihn veröffentlicht hast. Großartiger Text. Allein schon, was du über den Kommissar geschrieben hast – eine mürbe, ironische Koks-Feier, ein Rap mit einem böhmisch-jiddischen Zungenschlag, hahaha! Und du hast natürlich völlig recht, Falco ist im Moment der einzige Künstler, den wir hierzulande haben, der Bowie das Wasser reichen kann. Genau so will ich das! So einen Tonfall brauche ich von dir.« Mit diesen Worten startete der deutsche Konzertveranstalter Marek Lieberberg 1987 in ein Gespräch mit dem deutschen Rocksänger, Liedermacher und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze. Worum es in dem Telefonat ging? Kunze: »Ich hatte keinen Schimmer, wovon er sprach. Marek fuhr fort: Sagt dir das Musical Les Misà©rables etwas? Ich habe die Rechte für die deutschsprachige Erstaufführung gekauft. Das Ganze wird in Wien stattfinden, im Raimund Theater. Ich mache das zusammen mit Peter Weck. Und du wirst den Text übersetzen! […] Auf zwar wenigen, aber faszinierenden Seiten skizziert Kunze (in Zusammenarbeit mit Oliver Kobold) seine zweite Karriere als Übersetzer. »Marek, es freut mich wahnsinnig, dass du an mich gedacht hast. Aber wieso denkst du denn, dass ich dafür der Richtige sein könnte? Ich habe in meinem Leben nur Lola von den Kinks übersetzt, mehr nicht. Und mit Musicals kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe nicht mal ein einziges auch nur gesehen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass du das kannst. Höchste Zeit, dass mal ein frischer Wind reinkommt bei den deutschen Musical-Texten. Und du bist der richtige Mann dafür. Ich will einen anderen Zungenschlag, einen anderen Tonfall. Genauer, poetischer, musikalischer. Ich gebe dir drei Monate Probezeit, dann sehen wir weiter.« In den darauffolgenden Passagen schildert Kunze seine Arbeit am Text und in Wien vor Ort in der letzten heißen Phase vor der Premiere der Show 1988: »Der erste große Dialog zwischen Valjean, dem ehemaligen Häftling, und Javert, dem Polizisten, schnürte mir die Kehle zu. Enthüllt wird die Ähnlichkeit der beiden Männer, denn Javert ist selbst im Gefängnis aufgewachsen, als Sohn eines Wärters. Das ist der Grund für die Unerbittlichkeit, mit der er Verbrecher jagt – sie halten die Erinnerung an seine Kindheit wach, die er so gerne hinter sich lassen würde. Im Original lautete sein Geständnis: You know nothing of Javert / I was born inside a jail / I was born with scum like you / I am from the gutter, too! Besonders die Zeile I was born inside a jail kostete mich Nerven. Ich fand und fand keine Entsprechung, die mir gefiel. Erst als ich den Teil fürs Ganze nahm, wurde es Poesie und war nicht mehr nur Dienstleistung: Ich liebe die Zeilen bis heute. Was weißt du schon von Javert? / Gitter brach mein Wiegenlicht / Dreck sah meiner Mutter zu / Ich stamm aus dem Dreck wie du. Während der Proben in Wien holten sie bei solchen Passagen kurz Luft und steckten die Köpfe zusammen: Hos d’ dös g’hert, wos der do gschrieb’n hot?« »Miss Saigon«, Andrew Lloyd Webbers »Joseph« und »Rent« sind Kunzes weitere Karrierestationen als Übersetzer. Mit viel Witz und auch gnadenloser Offenheit skizziert er seine Sicht auf die Musicalbranche. Am Beispiel »Rent«: »An der Qualität des Musicals bestand keine Zweifel. Aber ob das deutsche Publikum wirklich zu einer Konfrontation mit dem richtigen Leben bereit war, noch dazu ohne entlastenden Orchesterschmelz, sondern mit der Wucht einer richtigen Rockband […]« Wir wissen, wie es ausging. »Rent« lief in Düsseldorf 1999 keine drei Monate, in Berlin nur wenig länger. Kunze: »Das deutsche Publikum fand keinen Zugang zu dem Stück und blieb beim Bewährten. Bei Zuckerguss und Utopie.« Aber nicht nur die Musicalpassagen entwickeln einen beeindruckenden Sog. Kunzes Autobiografie ist voller Anekdoten mit deutschen, österreichischen und internationalen Stars. Spannend, oft berührend, eine großartige Biografie, immer im Bestreben, den richtigen Tonfall zu treffen: »Peter Weck kam vorbei […] und wollte sich persönlich vom Fortgang der Proben überzeugen: »Na, Kinder, wos hobt’s Schöns ’mocht? Darf i amoi schaun? Charme, den man nicht lernen, nur haben kann. Das Wien von Sissi und Hans Moser; das Wien, das an der schönen blauen Donau liegt und wo im Prater wieder die Bäume blühen – wenn Peter Weck den Raum betrat, existierte es noch immer. Er setzte sich zwischen Gale Edwards und mich und ließ sich einige Szenen zeigen, erst nach einer Weile traute ich mich, den Kopf zu drehen. Weck liefen die Tränen übers Gesicht. Er weinte vor Glück. Und ich war plötzlich zehn Zentimeter gewachsen.«
»Hör mal, Heinz, ich bin gerade mit Falco auf Tour und habe den Artikel gelesen, den du in der Männer Vogue über ihn veröffentlicht hast. Großartiger Text. Allein schon, was du über den Kommissar geschrieben hast – eine mürbe, ironische Koks-Feier, ein Rap mit einem böhmisch-jiddischen Zungenschlag, hahaha! Und du hast natürlich völlig recht, Falco ist im Moment der einzige Künstler, den wir hierzulande haben, der Bowie das Wasser reichen kann. Genau so will ich das! So einen Tonfall brauche ich von dir.« Mit diesen Worten startete der deutsche Konzertveranstalter Marek Lieberberg 1987 in ein Gespräch mit dem deutschen Rocksänger, Liedermacher und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze. Worum es in dem Telefonat ging? Kunze: »Ich hatte keinen Schimmer, wovon er sprach. Marek fuhr fort: Sagt dir das Musical Les Misà©rables etwas? Ich habe die Rechte für die deutschsprachige Erstaufführung gekauft. Das Ganze wird in Wien stattfinden, im Raimund Theater. Ich mache das zusammen mit Peter Weck. Und du wirst den Text übersetzen! […] Auf zwar wenigen, aber faszinierenden Seiten skizziert Kunze (in Zusammenarbeit mit Oliver Kobold) seine zweite Karriere als Übersetzer. »Marek, es freut mich wahnsinnig, dass du an mich gedacht hast. Aber wieso denkst du denn, dass ich dafür der Richtige sein könnte? Ich habe in meinem Leben nur Lola von den Kinks übersetzt, mehr nicht. Und mit Musicals kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe nicht mal ein einziges auch nur gesehen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass du das kannst. Höchste Zeit, dass mal ein frischer Wind reinkommt bei den deutschen Musical-Texten. Und du bist der richtige Mann dafür. Ich will einen anderen Zungenschlag, einen anderen Tonfall. Genauer, poetischer, musikalischer. Ich gebe dir drei Monate Probezeit, dann sehen wir weiter.« In den darauffolgenden Passagen schildert Kunze seine Arbeit am Text und in Wien vor Ort in der letzten heißen Phase vor der Premiere der Show 1988: »Der erste große Dialog zwischen Valjean, dem ehemaligen Häftling, und Javert, dem Polizisten, schnürte mir die Kehle zu. Enthüllt wird die Ähnlichkeit der beiden Männer, denn Javert ist selbst im Gefängnis aufgewachsen, als Sohn eines Wärters. Das ist der Grund für die Unerbittlichkeit, mit der er Verbrecher jagt – sie halten die Erinnerung an seine Kindheit wach, die er so gerne hinter sich lassen würde. Im Original lautete sein Geständnis: You know nothing of Javert / I was born inside a jail / I was born with scum like you / I am from the gutter, too! Besonders die Zeile I was born inside a jail kostete mich Nerven. Ich fand und fand keine Entsprechung, die mir gefiel. Erst als ich den Teil fürs Ganze nahm, wurde es Poesie und war nicht mehr nur Dienstleistung: Ich liebe die Zeilen bis heute. Was weißt du schon von Javert? / Gitter brach mein Wiegenlicht / Dreck sah meiner Mutter zu / Ich stamm aus dem Dreck wie du. Während der Proben in Wien holten sie bei solchen Passagen kurz Luft und steckten die Köpfe zusammen: Hos d’ dös g’hert, wos der do gschrieb’n hot?« »Miss Saigon«, Andrew Lloyd Webbers »Joseph« und »Rent« sind Kunzes weitere Karrierestationen als Übersetzer. Mit viel Witz und auch gnadenloser Offenheit skizziert er seine Sicht auf die Musicalbranche. Am Beispiel »Rent«: »An der Qualität des Musicals bestand keine Zweifel. Aber ob das deutsche Publikum wirklich zu einer Konfrontation mit dem richtigen Leben bereit war, noch dazu ohne entlastenden Orchesterschmelz, sondern mit der Wucht einer richtigen Rockband […]« Wir wissen, wie es ausging. »Rent« lief in Düsseldorf 1999 keine drei Monate, in Berlin nur wenig länger. Kunze: »Das deutsche Publikum fand keinen Zugang zu dem Stück und blieb beim Bewährten. Bei Zuckerguss und Utopie.« Aber nicht nur die Musicalpassagen entwickeln einen beeindruckenden Sog. Kunzes Autobiografie ist voller Anekdoten mit deutschen, österreichischen und internationalen Stars. Spannend, oft berührend, eine großartige Biografie, immer im Bestreben, den richtigen Tonfall zu treffen: »Peter Weck kam vorbei […] und wollte sich persönlich vom Fortgang der Proben überzeugen: »Na, Kinder, wos hobt’s Schöns ’mocht? Darf i amoi schaun? Charme, den man nicht lernen, nur haben kann. Das Wien von Sissi und Hans Moser; das Wien, das an der schönen blauen Donau liegt und wo im Prater wieder die Bäume blühen – wenn Peter Weck den Raum betrat, existierte es noch immer. Er setzte sich zwischen Gale Edwards und mich und ließ sich einige Szenen zeigen, erst nach einer Weile traute ich mich, den Kopf zu drehen. Weck liefen die Tränen übers Gesicht. Er weinte vor Glück. Und ich war plötzlich zehn Zentimeter gewachsen.«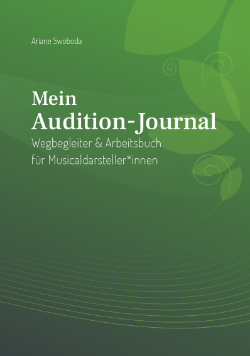 Die Situation kennt jeder. Man steht vor einer Herausforderung und sucht … Orientierung, Tipps, Hilfe, möglichst in einer Form, die eine Instant-Erleichterung verschafft, etwa indem grundlegende Fragen leicht erfassbar erklärt werden, Aspekte, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als wichtig erkannt hat, thematisiert werden. Profis mit möglichst reicher Erfahrung sind in all diesen Fällen die Ansprechpartner der Wahl.
Die Situation kennt jeder. Man steht vor einer Herausforderung und sucht … Orientierung, Tipps, Hilfe, möglichst in einer Form, die eine Instant-Erleichterung verschafft, etwa indem grundlegende Fragen leicht erfassbar erklärt werden, Aspekte, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als wichtig erkannt hat, thematisiert werden. Profis mit möglichst reicher Erfahrung sind in all diesen Fällen die Ansprechpartner der Wahl.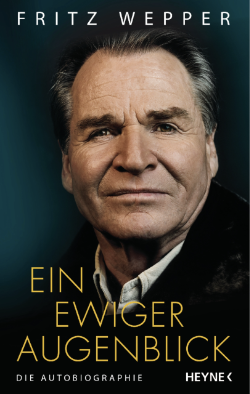 Im Mai 1973 eröffnete sich dem deutschen Schauspieler Fritz Wepper die Chance seines Lebens. Im Zuge eines Promotion-Trips nach New York für das Filmmusical »Cabaret« hatte der 31-Jährige ein Meeting mit der Music Corporation of America (MCA), der damals einflussreichsten Schauspieleragentur Hollywoods, bei der Größen wie Kirk Douglas, Fred Astaire, James Stewart und Bette Davis unter Vertrag standen. Die Vertreter kamen mit konkreten Angeboten: ein Theaterstück am Broadway, danach ein Film in Kanada und ein weiterer in Los Angeles. Auf die Frage nach seinen terminlichen Verpflichtungen antwortete Wepper bei diesem Treffen: »I’m busy this year and I have an option for next year.« Ein fataler Fehler. »Forget it, Fritz. Good luck«, war die Antwort der Vertreter der Agentur. Der Grund für die Abfuhr: Der Begriff »Option« bedeutet im Deutschen für einen Schauspieler ein Rollenangebot, das er auch ablehnen kann. Im amerikanischen Fachjargon besagt eine solche Aussage allerdings, dass man vertraglich gebunden ist. Die MCA ging davon aus, dass Wepper nicht vor 1975 verfügbar sei, und hatte ihr Interesse an ihm verloren.
Im Mai 1973 eröffnete sich dem deutschen Schauspieler Fritz Wepper die Chance seines Lebens. Im Zuge eines Promotion-Trips nach New York für das Filmmusical »Cabaret« hatte der 31-Jährige ein Meeting mit der Music Corporation of America (MCA), der damals einflussreichsten Schauspieleragentur Hollywoods, bei der Größen wie Kirk Douglas, Fred Astaire, James Stewart und Bette Davis unter Vertrag standen. Die Vertreter kamen mit konkreten Angeboten: ein Theaterstück am Broadway, danach ein Film in Kanada und ein weiterer in Los Angeles. Auf die Frage nach seinen terminlichen Verpflichtungen antwortete Wepper bei diesem Treffen: »I’m busy this year and I have an option for next year.« Ein fataler Fehler. »Forget it, Fritz. Good luck«, war die Antwort der Vertreter der Agentur. Der Grund für die Abfuhr: Der Begriff »Option« bedeutet im Deutschen für einen Schauspieler ein Rollenangebot, das er auch ablehnen kann. Im amerikanischen Fachjargon besagt eine solche Aussage allerdings, dass man vertraglich gebunden ist. Die MCA ging davon aus, dass Wepper nicht vor 1975 verfügbar sei, und hatte ihr Interesse an ihm verloren. Sieht man sich auf amazon.com die Bewertungen der Käufer des hier besprochenen Buches an, fällt der relativ hohe Prozentsatz an Ein-Stern-Urteilen auf. Mehr als 30 Prozent entschieden sich dafür, dem Buch die schlechteste aller möglichen Noten zu geben. Der Großteil davon gibt als Grund nicht etwa den Text an, sondern bemängelt die Herstellung des Buchs an sich. Der Buchblock habe sich vom Einband gelöst, der Buchkern sei aufgebrochen. Warum der Verlag eher eine günstigere Herstellungsweise einkalkuliert haben könnte, ist aber vielleicht ironischerweise an genau diesen Bewertungen abzulesen. Auf amazon.com haben das im April 2021 erschienene Buch 18 Käufer, auf amazon.de um sechs weniger bewertet. Wünschen darf man sich viel, auch teuer produzierte Bücher, aber Verlage müssen die finanziellen Möglichkeiten vor dem Hintergrund einer absetzbaren Auflage im Auge behalten. Früher oder später werden Fachbücher wie diese vielleicht nur mehr digital angeboten. Der Preis wird dann nicht wesentlich tiefer liegen.
Sieht man sich auf amazon.com die Bewertungen der Käufer des hier besprochenen Buches an, fällt der relativ hohe Prozentsatz an Ein-Stern-Urteilen auf. Mehr als 30 Prozent entschieden sich dafür, dem Buch die schlechteste aller möglichen Noten zu geben. Der Großteil davon gibt als Grund nicht etwa den Text an, sondern bemängelt die Herstellung des Buchs an sich. Der Buchblock habe sich vom Einband gelöst, der Buchkern sei aufgebrochen. Warum der Verlag eher eine günstigere Herstellungsweise einkalkuliert haben könnte, ist aber vielleicht ironischerweise an genau diesen Bewertungen abzulesen. Auf amazon.com haben das im April 2021 erschienene Buch 18 Käufer, auf amazon.de um sechs weniger bewertet. Wünschen darf man sich viel, auch teuer produzierte Bücher, aber Verlage müssen die finanziellen Möglichkeiten vor dem Hintergrund einer absetzbaren Auflage im Auge behalten. Früher oder später werden Fachbücher wie diese vielleicht nur mehr digital angeboten. Der Preis wird dann nicht wesentlich tiefer liegen. Vorliegendes Buch ist eine Zusammenstellung von Beiträgen, die für ein Symposion erarbeitet wurden, das 2017 in Freiburg stattfand. Etwas allgemeiner formuliert war der Anlass für den Band der Umstand, dass die Geschichte der Kunstform Musical (und der Operette) in manchen Ländern aufgrund bestimmter Hemmnisse nicht geschrieben wird beziehungsweise über die Landesgrenzen hinaus nicht bekannt ist.
Vorliegendes Buch ist eine Zusammenstellung von Beiträgen, die für ein Symposion erarbeitet wurden, das 2017 in Freiburg stattfand. Etwas allgemeiner formuliert war der Anlass für den Band der Umstand, dass die Geschichte der Kunstform Musical (und der Operette) in manchen Ländern aufgrund bestimmter Hemmnisse nicht geschrieben wird beziehungsweise über die Landesgrenzen hinaus nicht bekannt ist.


